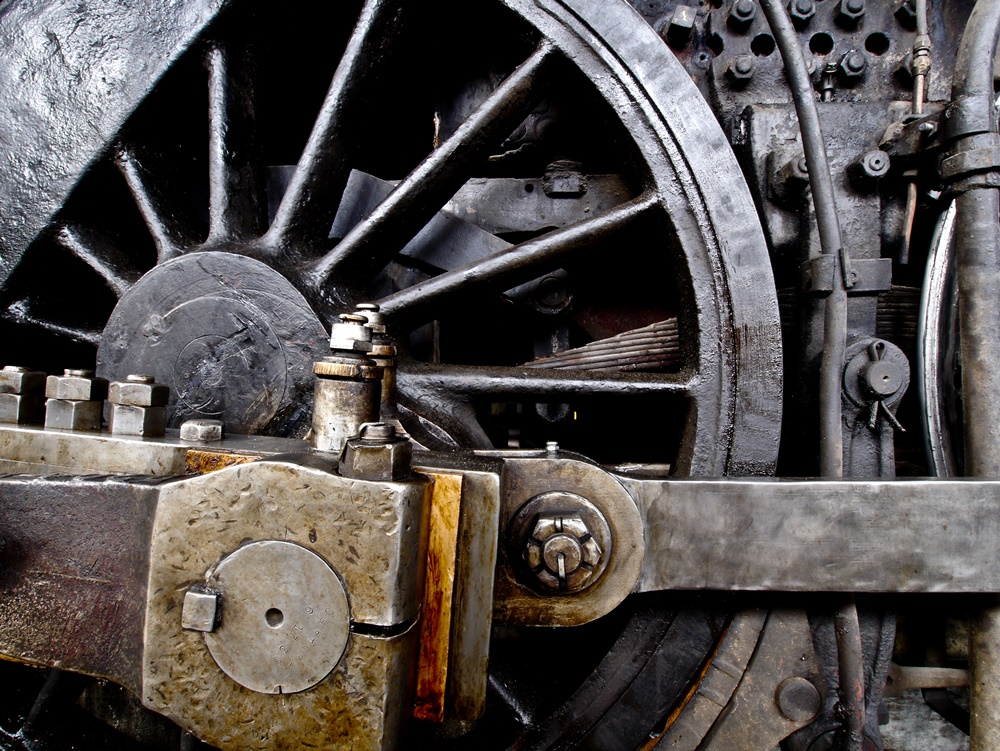Der Narrenturm verfällt. Das darin eingemietete Pathologisch-anatomische Bundesmuseum wird von seinem Ministerium seit Jahren nicht einmal ignoriert. Wie wir unser Erbe verplempern.
Den Viktor-E.-Frankl-Weg gibt es nicht. Dabei ist er doch gut 500 Meter lang und zumindest an seinem Anfang und an seinem Ende beschildert. Aber kein Straßenverzeichnis weiß von ihm, kein Stadtplan kennt seinen Namen. Der Viktor-E.-Frankl-Weg durchmisst das Alte AKH in Wien: von der Ecke Spitalgasse/Alser Straße bis zur Sensengasse, von der geschniegelten und geschneuzten neuen Uni-Campus-Herrlichkeit bis in den nördlichsten, den vergessenen Winkel, dorthin, wo das Alte AKH noch so richtig alt ausschaut, das Glasscherbengrätzel des Geländes, das noch keine Schniegler und keine Schneuzer gesehen hat: dorthin, wo sich der Narrenturm auf milder Anhöhe über ein tristes Nebenan erhebt, fünf Geschoße hoch, gut 28 Meter im Durchmesser.
Und so wie der Viktor-E.-Frankl-Weg zwar unleugbar vorhanden, und doch amtlicherseits nicht wirklich wahrgenommen ist, mag auch der Narrenturm samt seinem Inhalt, dem Pathologisch-anatomischen Bundesmuseum, zwar schwer zu übersehen sein – und wird doch seit Jahren, fast Jahrzehnten amtsbehandelt, als wär‘ er Luft. Ausgestoßen, weggeschoben, nicht einmal ignoriert. Bis der letzte Brocken Putz aus der Fassade fällt.
Zugegeben, sie sind ja wirklich ein sonderbares Paar: der Paria unter den heimischen Baudenkmälern ersten Ranges und der Paria unter den heimischen Bundessammlungen, hie Wahnsinn, da Krankheit und Tod. Das ist nicht das Terrain, auf dem sich politisch reüssieren ließe, wo gar Wahlen zu gewinnen wären. Umso leichter, gerade hier den falschen Satz zur falschen Zeit zu sagen, den falschen Schritt im falschen Augenblick zu tun.
„Unser größtes Problem ist“, weiß Beatrix Patzak, seit 1993 Leiterin des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums, „dass an uns der Geruch der Psychiatrie haftet und dass unsere Sammlung nicht zuletzt Leichenteile umfasst. Und beides ist in Wirklichkeit völlig tabuisiert. Jeder, der sich mit uns beschäftigt, muss über diese Hürden einmal drüberkommen.“ Und wer tut sich das schon an, wenn andernorts so viel einfacher und mit größeren Gewinnaussichten politisch zu agieren ist?
Im Frühjahr 1783 beginnen auf Anordnung Kaiser Josephs II. die Arbeiten zum Umbau des bestehenden „Großarmenhauses“ in Wiens Allgemeines Krankenhaus. Ein Teil der neuen Anlage, der Joseph offenkundig besonders angelegen ist: der alsbald „Narrenturm“ genannte Bau, ein ringförmiges Gebäude, über dessen Erstbelegung im April 1784 der Kaiser seinem Leibarzt und AKH-Chefplaner Joseph Quarin in einem „Handbillet“ erstaunlich detaillierte Vorschriften macht: „1. In die 28 Zimmer des obersten Stockwerkes des Irrenthurmes kommen aus dem spanischen Spitale die 3 unreinen und die 10 von St. Marx zu zwei und zwei, also in 7 Kammern, jeder angeschmiedet. In den übrigen der 21 Kammern kommen von den 48 unruhigen 21 hinauf, Jeder einzelweis. 2. In den darunter befindlichen niederen Stock kommen dann die übrigen 27, ebenfalls unruhigen und müssen auch einzelweis verbleiben.“ Und so weiter und so fort bis ins Erdgeschoß.
Worin man nicht unbedingt, wie Alfred Stohl in seinem Buch „Der Narrenturm oder Die dunkle Seite der Wissenschaft“, einen Beleg dafür sehen muss, dass es dem Kaiser in Wahrheit nicht um eine zeitgemäße Verwahrung „Hinfallender“, „Militär-Irrer“, „Incurabler“ oder sonstwie Auffälliger getan gewesen sei, sondern um die Errichtung eines Horts der Alchimie, einem geheimnisvollen Zahlensystem folgend, das sich in Maßen und Strukturen des Gebäudes niederschlage. Auffällig freilich ist es allemal, wenn Zeitgenossen zu berichten wissen, Joseph habe auf den Narrenturm nicht nur „bedeutende Summen“ verwandt, sondern auch „lebhafteste Teilnahme an dem Zustand der Verrückten“ gezeigt, ja das Haus sogar „wöchentlich einmal, zuweilen zweimal“ besucht, was für den Herrscher über ein europäisches Großreich, der vermutlich auch noch anderes zu tun hatte, in der Tat eine bemerkenswerte Frequenz wäre.
Fakt ist, dass der Narrenturm heute manchen als der „weltweit erste Spezialbau zur Unterbringung von Geisteskranken“ gilt; Fakt ist auch, dass er wie viele einer visionären Idee geschuldeten Werke gleichsam vom ersten Tage unter maßgeblichen Mängeln litt: Das Abflusssystem versagte seinen Dienst, der ursprünglich in jeder Zelle vorhandene Abtritt mit angeschlossenem Kanal musste alsbald durch Kübel oder „Abortkisten“ ersetzt werden. Die zentrale Beheizung über Luftschächte lenkte vor allem die Abgase der unterirdisch untergebrachten Öfen in die Zellen. Das Ergebnis aus der Perspektive eines Anonymus des ausgehenden 18. Jahrhunderts: „Die Kamine gaben zum Theil einen dicken Rauch, zum Theil aber eine widerwärtig kalte Luft von sich. Das Ding muss wieder so eines von den zahlreichen papierenen Projekten gewesen seyn, woran die Wiener Stubengelehrten so fruchtbar seyn sollen.“
Fazit: Schon wenige Jahre nach der Eröffnung ist der eben noch Avantgarde gewesene Bau einigermaßen out of date. Es wird aber bis in die Sechzigerjahre des 19. Jahrhunderts dauern, ehe man den Plan fasst, die Patienten aus dem Narrenturm abzusiedeln. 1869 geht der Narrenturm samt seinen 139 Zellen endgültig seiner ursprünglichen Funktion verlustig. Interessant nur, dass dieselben Zellen alsbald als Schwesternwohnheim oder auch für Ärztedienstwohnungen taugen, und das noch bis weit ins 20. Jahrhundert.
Mit Pathologie, Anatomie oder gar einem dazu passenden Museum hat all das zunächst gar nichts zu tun. Als Johann Peter Frank 1795 zum ärztlichen Direktor des Allgemeinen Krankenhauses bestellt wird, ist ihm der Bau eines geräumigen Leichenhauses mit einem eigenen Obduktionszimmer ein großes Anliegen. „Frank sah in der pathologischen Leichenöffnung die Chance, die ärztlichen Kenntnisse zu erweitern“, erläutert der Pathologe Roland Sedivy in seinem vor wenigen Monaten erschienenen Band „Pathologie in Fallstudien“. Und: „Als didaktisches Anschauungsmaterial waren ihm dabei die Feuchtpräparate spezieller und spezifischer Organveränderungen unentbehrlich, und so verfügte er neben der Errichtung eines Leichenhauses 1796 auch die eines pathologisch-anatomischen Museums.“ Immerhin 400 Präparate sollen in den Folgejahren angefertigt worden sein, untergebracht in der Prosektur des AKH, keines davon konnte allerdings bisher im heutigen Museumsbestand identifiziert werden.
Im Oktober 1811 ordnet Kaiser Franz I. die „Verfertigung instruktiver Präparate“ und die „Sammlung aller Merkwürdigkeiten, die sich an den Leichnamen darbieten“ an, welchselbige in die „Cabinette“ abzuliefern seien. Und ab dieser Zeit wächst die Sammlung kontinuierlich. Als das Pathologisch-anatomische Museum 1971 in den Narrenturm übersiedelt, sind gut 7000 Exponate zu transportieren; heute wären es, nach Übernahme zahlreicher in- wie ausländischer Sammlungen, mehr als 50.000 Stück, weshalb Beatrix Patzak mit Recht behaupten darf, Herrin über die weltweit größte einschlägige Institution zu sein. Gesamtaufwand zuletzt: keine 300.000 Euro. Jährlich.
Dass es hier bis zum heutigen Tage um medizinische Forschung und nicht um die Befriedigung der Schaulust geht, wie man sie aus den „Körperwelten“ des Leichen-Plastinateurs Gunther von Hagens kennt, wird niemanden überraschen. „Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae“, steht denn auch über dem Zugang zum Pathologisch-anatomischen Bundesmuseum zu lesen, und Beatrix Patzak wird nicht müde, in Vorträgen und Gesprächen darauf einzugehen, wie man sich denn genau diesen Ort vorzustellen habe, an dem der Tod dem Leben hilft. „Kürzlich ist ein Neurochirurg aus Deutschland gekommen, der sich mit Verengungen des Wirbelkanals befasst; da steht man vor der Frage: Ab wann operiert man, ab wann muss man konservativ arbeiten? Dazu kann man sich die Präparate anschauen, die wir hier haben, man dokumentiert sie, dann suchen wir den Sektionsbefund heraus, und all das fließt in die Arbeit ein.“
Vor drei Jahren wiederum sei es gelungen, aus einem Magenpräparat des Jahres 1900 das Bakterium Helicobacter pylori zu isolieren, das für eine große Zahl von Magenkrankheiten verantwortlich gemacht wird: „Ärzte aus dem AKH wollen jetzt dessen DNA-Code knacken und überprüfen, ob sich der im Lauf der 100 Jahre verändert hat oder nicht.“ Und noch viel mehr Erkenntnis dieser Art ließe sich aus den historischen Präparaten gewinnen – „wenn wir die finanziellen Mittel hätten“. Wenn.
Mai 1997: Die Grün-Abgeordneten „Madeleine Petrovic und FreundInnen“ richten an Ministerin Gehrer die „schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2410/J-NR/97 betreffend desaströser Zustand des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums im Narrenturm“. Die Ministerin antwortet: Das Gebäude des Museums, also der Narrenturm, befinde sich im Alten AKH, das sei Eigentum der Universität Wien, das Museum nur Mieter, weshalb „die Universität Wien die dem Hauseigentümer obliegenden Instandsetzungs- und Instandhaltungspflichten zu tragen hat“. Aber immerhin, und generös wie man ist, werde man sich der Reparatur der Wasser- und Stromversorgung annehmen – zumindest „soweit der Mieter für die Reparaturen aufzukommen hat“. Die Pläne für die Zukunft des Museums? Schmeck’s. Drei weitere parlamentarische Anfragen der Grünen werden in vergleichbarer Sache folgen, die jüngste aus dem Juni 2005 datierend, und die Antworten werden jeweils sublim zwischen Abputzen und interesseloser Beiläufigkeit changieren. Und selbst wenn einmal Reformkonzepte amtlicherseits in Aussicht gestellt werden, ihr Präsentationsdatum ist der Sanktnimmerleinstag.
Dass ausgerechnet das Pathologisch-anatomische direkt am ministeriellen Tropf verbleibt, während alle anderen Bundesmuseen 1998 in Vollrechtsfähigkeit entlassen werden, passt ins Bild, wiewohl sich wenigstens dafür auch rationale Argumente finden lassen: etwa dass „menschliche Körperteile niemandes Eigentum sind und daher nicht Gegenstand eines Rechtsgeschäfts sein“ können, wie Beatrix Patzak meint. Oder auch – im Vergleich zu anderen Bundesmuseen – die allzu bescheidene Größe der Institution, die Elisabeth Gehrer ins Treffen führte.
Freilich: All das vermag nur unvollkommen zu erklären, warum – und nur so beispielsweise – im „Täglichen Programm der Bundesmuseen“, wie es sich auf der Website des nunmehrigen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (www.bmukk.gv.at/kultur/museen.xml) findet, jeder Hinweis auf das Pathologisch-anatomische Bundesmuseum und seine aktuelle Veranstaltungsreihe, „Tower of Power“, fehlt. Hat man es denn klammheimlich mittlerweile aus dem Bundesverband gekickt?
Wer sich gar anschickt, den ministeriellen Status quo in einschlägiger Sache zu erkunden, sieht sich alsbald in einem bürokratischen Veitstanz, in dem keiner mehr zu wissen scheint, wer wo was mit wem in welcher Sache vereinbart hat und wer wo was von wem eigentlich erfahren müsste, vielfach durchsetzt von partieller Amnesie. Da erläutert A in der zuständigen Fachsektion des Ministeriums, eine Sanierung des Gebäudes müsse, siehe oben, der Eigentümer, Universität Wien, in die Wege leiten, der müsse an das Ministerium herantreten, worauf das Ministerium erst seinerseits in Sachen Kostendeckung tätig werden könne. Da habe es zwar zig Gespräche gegeben, aber soweit A informiert sei, liege der Ball noch immer bei der Universität. Und im Übrigen wisse Ministeriumskollege B sicher Näheres.
B seinerseits kann sich weder an Gespräche noch an etwaige universitäre Gesprächspartner erinnern. Im Rektorat der Universität wiederum stößt man auf maßloses Erstaunen, denn zum einen hege die Universität über die Wichtigkeit des Narrenturms keine Zweifel, zum anderen habe es doch erst kürzlich ein offizielles Schreiben an das Ministerium in dieser Sache gegeben, und der Vorwurf, der da „irgendwie im Raum“ stehe, der treffe einfach nicht zu: aus Sicht der Universität – wie auch aus Sicht ihres ministeriellen Ansprechpartners C.
Was C, man wagt es kaum zu glauben, nicht dementiert, sondern bestätigt. Aber: Er habe ein Verbot, mit der Presse zu sprechen. Also habe ich nicht einmal seine Bestätigung offiziell gehört. Und all die anderen hochgeheimen Staatsgeheimnisse, von denen mir C im Anschluss noch gut 20 Minuten lang in Form nicht zitabler „Hintergrundinformation“ berichtet, die hat mir meinetwegen ein D erzählt: dass derzeit ein Geschäftsmodell in Verhandlung sei, den Narrenturm kostenschonend zu sanieren; dass weder von einer Aussiedlung des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums noch von einer Zusammenlegung mit ähnlichen hiesigen Institutionen die Rede sein könne, Ideen, wie sie bis in die jüngste Vergangenheit immer wieder die Runde machten; oder dass sich jenseits einer Vollrechtsfähigkeit auch mildere Formen wirtschaftlicher Flexibilität für das Museum denken ließen. Wieso die Fachsektion davon nichts wisse? Ach, die Fachsektion! Und auch Beatrix Patzak versichert glaubhaft, nicht eingeweiht zu sein: Je nun, sie ist ja nur die Leiterin der Institution, über deren Zukunft da gerade entschieden wird.
In Wahrheit vermag sie solches freilich längst nicht mehr zu überraschen. Da war doch auch die Sache mit der Provenienzforschung: „Wir haben unsere Bestände aus den Jahren 1938 bis 1945 überprüft, ob es da Objekte gibt, die unter fragwürdigen Umständen gewonnen wurden. Und wir haben insgesamt fünf entsprechende Präparate gefunden, die man bestatten sollte. Diese Empfehlung habe ich sofort ans Ministerium geschickt – nur komischerweise: Die Hälfte meiner Post verschwindet.“ Trotz mehrmaliger Überstellungsversuche habe ihre Empfehlung bis dato das Ministerium nicht erreicht. Macht nichts: Dort hat man mittlerweile ohnehin überhaupt noch nie von so etwas wie Provenienzforschung in Sachen Pathologisch-anatomisches Museum gehört: Die Provenienzforschung beziehe sich nur auf Kunstgegenstände, wird mir vom zuständigen Beamten beschieden, weshalb man auch keine solche im Pathologisch-anatomischen Bundesmuseum „veranstaltet“ habe. Und dass Ministerin Gehrer auf eine parlamentarische Anfrage hin noch vor zwei Jahren das gerade Gegenteil behauptet hat, das ist vielleicht unter einer neuen Ministerin nicht mehr von Belang.
„Der Narrenturm hat ein Riesenglück: Der ist so stabil, dass er nicht von selber zusammenfallen kann“, weiß der Wiener Architekt Thomas Kratschmer, der 1999 eine Studie „über die Restaurierung des Narrenturms und über die Neuordnung des Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums“ vorgelegt hat. Und die Wiener Landeskonservatorin, Barbara Neubauer, ergänzt: „Für einen Denkmalpfleger ist das kein Horrorobjekt, wo er sofort Hand anlegen müsste. Der Putz fällt halt herunter, okay.“ Aber: „Dass es sinnvoll wäre, den Narrenturm, der ja doch ein einzigartiges Denkmal ist, in einen besseren Stand zu versetzen, ist keine Frage. Das wird Ihnen jeder sagen.“
Die Tage, in denen Beatrix Patzak ihre Sammlung und deren Quartier mit allen – auch körperlichen – Mitteln verteidigen musste, und sei es dadurch, den amtierenden Rektor vor die Tür zu setzen, die scheinen zwar vorbei. Die neuen, die anderen, die konstruktiven Zeiten sind freilich längst noch nicht angebrochen. So bleiben ihr vorerst nur die kleinen Siege, Entdeckungen wie das Skelett, das sie behutsam hervorholt, wenn man sie nach den besonderen Stücken des Hauses fragt: „Von diesem Präparat haben wir nicht gewusst, was es ist. Die Konservierungsflüssigkeit war völlig eingedickt, undurchsichtig. Wir haben dann den Inhalt präparieren lassen, und herausgekommen ist dieses Skelett eines Kindes. Wir sehen hier eine Fehlbildung, bei der wir bis heute nicht wissen, was wir machen können: die Glasknochenkrankheit. Und wenn man dieses Skelett in der Hand hat, dann ist es kein Präparat mehr, dann ist es ein Kind. Das ist das, was wir zu vermitteln versuchen. Es kommt einfach nur darauf an, wie man das Präparat sieht, es wird wieder zum Menschen.“
Und wenn es denn irgendwo ganz diesseitig und materiell ein Leben nach dem Tod gibt: Auf den fünf Etagen des Narrenturms ist es zu finden. In Vitrinen, auf Regalen, in Schränken, aufgehängt an Haken, allgemein zugänglich in der kleinen Schausammlung, großteils Studienzwecken vorbehalten, kein Jahrmarkt des Morbiden, eine Feier des Überlebens – und sei’s auch nur eines in Formaldehyd.
Mit einem „Bundesgruselmuseum“, wie die Institution auch schon genannt wurde, hat das jedenfalls nichts zu tun. Das Gruseln, das lehrt man anderswo.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 7. Juli 2007