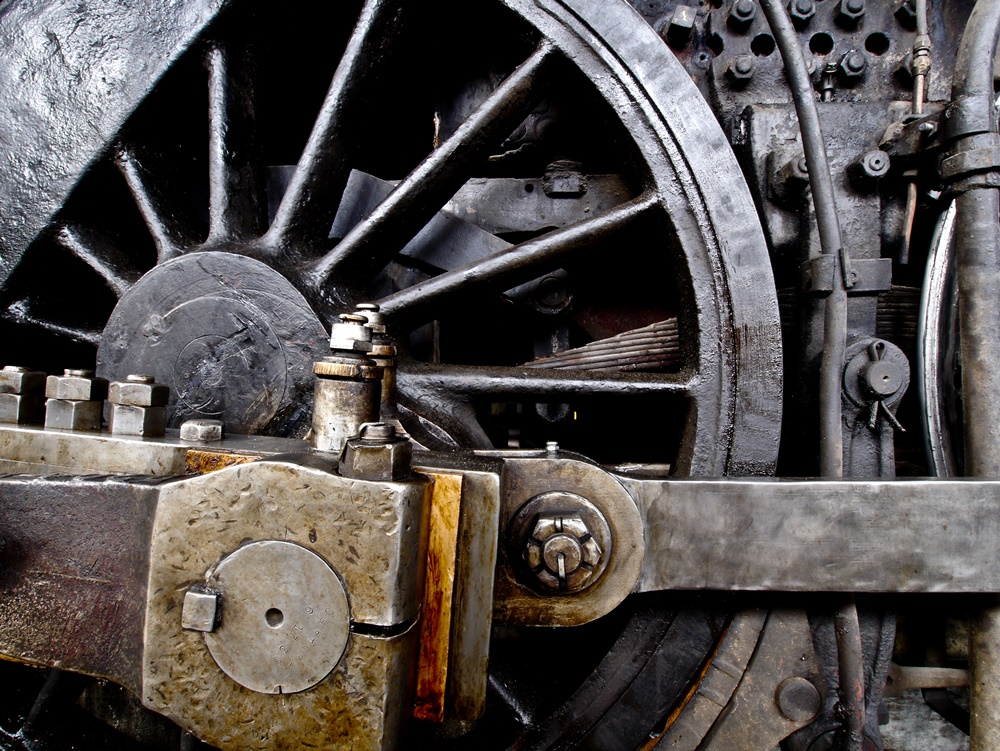Seit Tagen schaue ich, da ich diese Zeilen schreibe, auf die Leerstelle in meinem Garten, die mein alter Marillenbaum hinterlassen hat. Gut 90 Jahre alt, wurde er vergangenen Montag gefällt. Vom Wachsen, Vergehen und neu Entstehen: Kagraner Marginalien zur Wiener Siedlerbewegung.
Montags um acht war die Welt noch in Ordnung. Nicht die große, weite, wann wäre die je in Ordnung gewesen. Nein, die bescheidene Gartenwelt, die sich, 80 Quadratmeter klein, hinter meinem Siedlungshaus zu Kagran gegen Osten streckt. Gewiss, sogar diese Siedlungsgartenordnung strebt wie alles im Kosmos, ewigen Gesetzen folgend, stets der Unordnung zu, wer wäre Gärtner und wüsste das nicht. Doch bei allem, was da immer vor sich ging, ob sommers, ob winters, bei Regen, bei Schnee, stand da, umtost vom Toben der Jahre, der eine, der Ordnung und Orientierung schuf, wie sehr sich auch alles im Chaos von Wachsen, Werden und wieder Vergehen verlor: ein Marillenbaum, Maßstab für alles, was rundum geschah, als könnt’s nicht anders sein und als sei er selbst längst enthoben den Zwängen, die der Zirkel des Lebens jedem sonst aufdrängt.
Vergangenen Montag um acht in der Früh stand er genauso noch da, von zahllosen Stürmen geschüttelt, doch stets ungerührt dem Augenschein nach. Zwar hatte ihm die Zeit Wunden geschlagen, zweimal hatte die Last der Früchte, die er trug, ihn zerbrechen lassen, doch stets hatte er sich aus eigener Kraft neu erschaffen, ein Monarch, der nicht willens schien, sein Siedlungsimperium je aufzugeben, ein Imperium, das er sich, bis ins Kernholz redlich, nicht ererbt, sondern durch Beharrlichkeit gleichsam erwachsen hatte, letzter Zeuge aus der Anfangszeit der Freihofsiedlung, den Zwanzigerjahren, einer Zeit, von der rund um ihn kaum einer noch wusste, mancher auch gar nichts mehr wissen wollte, den einen zu fern, zu fremd jene Tage, zu schmerzhaft anderen vielleicht.
Vergangenen Montag war die Regentschaft zu Ende, erst fielen die Äste, der Stamm folgte bald. Gestürzt lag der Monarch um halb zehn Uhr morgens vor mir, eben noch Alleinherrscher gewesen in einem Reich, das ohnehin schon lang nicht mehr das seine gewesen: ein Gartenreich, das in nichts mehr jenem glich, dem er einst entwachsen, und das doch noch immer Glück spendete jenen, die es bewohnten, wenngleich auf ganz andere Art, als anfangs gedacht.
„Der Garten ist das Primäre, das Haus ist das Sekundäre.“ Kein Geringerer als Adolf Loos definiert schon früh, 1920, die Grundmaxime, der die Siedlerbewegung gehorchen muss, soll sie ihren Zweck erfüllen. Loos weiter, kompromissverweigernd wie oft: „Nur der Mensch, der das Bedürfnis hat, durch Gartenarbeit neben seinem Beruf Nahrungsmittel zu schaffen, hat das Recht, Boden für sich von der Allgemeinheit in Anspruch zu nehmen.“ Und: „Das Sichfreuen am Garten hat nur im Anbauen von Nahrungsmitteln zu bestehen.“
Womit wir Lang- und Längstnachgeborenen unmittelbar auf die Wurzeln der Siedlerbewegung verwiesen sind: die elementaren Versorgungsnöte während und nach Ende des Ersten Weltkriegs. Die „Kriegsgemüsegärten“, in die hungrige Massen jedes nur greifbare Stückchen städtisches Land vor 1918 verwandeln, finden nach 1918 (und angesichts ungemindert bedrückender Nahrungsmittelknappheit) rasch in wilden Landnahmen ihre Fortsetzung, jetzt freilich mit dem Ziel, den Landnehmern nicht nur durch Eigenanbau von Feldfrüchten aller Art das Überleben zu sichern, sondern darüber hinaus durch Errichtung schlichtester Behausungen ein Dach über dem Kopf zu geben.
Was als disparate Mischung aus bürgerlich, sozialistisch oder gar anarchistisch Bewegten beginnt, organisiert sich alsbald in Genossenschaften. Mit der Einrichtung eines eigenen Siedlungsamts treibt eine eben erst sozialdemokratisch gewordene Stadtregierung die Institutionalisierung der Siedlerei weiter voran – und verleibt sie kurzerhand dem Roten Wien ein, als wär sie nie anders als sozialdemokratisch gewesen.
Auffallend rasch, den Nöten der Zeit gehorchend, ist ein Organisationsprinzip gefunden: Grund und Boden wird von der Stadt bereitgestellt, das Siedlungsamt steuert die Planung bei, Baumaterial wird von der gleichfalls eigens gegründeten Gemeinwirtschaftlichen Siedlungs- und Baustoffanstalt der Gemeinde geliefert (die unter dem Kürzel Gesiba in der Nachkriegszeit zu einem der größten gemeinnützigen Bauträger Österreichs wächst), die Errichtung der Siedlungshäuser wiederum liegt nicht zuletzt in Händen der künftigen Siedler selbst: Statt Kapital (über das ohnehin keiner von ihnen verfügt) bringen sie ihre Arbeitsleistung in die Genossenschaften ein.
Auf diese Weise entstehen in knapper Folge an den Wiener Peripherien mehrere Siedlungsrayone, der größte von ihnen unweit des transdanubischen Ortsteils Kagran: „Am Freihof“, errichtet im Zusammenwirken gleich dreier Genossenschaften, die sich alsbald zu einer einzigen zusammenschließen werden – der Siedlungsunion, die bis heute besteht und mittlerweile ihre ursprüngliche Kernkompetenz, eben den Reihenhausbau, längst für (immerhin stets human dimensionierten) Mehrgeschoßwohnbau aufgegeben hat.
Mehrgeschoßer, ja regelrechte „Volkswohnpaläste“ sind es auch, die schon früh in sozialdemokratischen Wohnbauprogrammen die Flachbauten der Siedlerei in den Hintergrund drängen. Und Grund dafür wird gewiss nicht nur die von allem Anfang an unübersehbare Tatsache sein, dass sich übereinandergestapelt mehr Menschen je Quadratmeter Grundfläche unterbringen lassen als in weitläufigen Reihenhausquartieren. Auch die Idee eines „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ scheint mit dem eher individualistischen Siedlerglück im Kleingarten nicht ideal kompatibel, ganz zu schweigen vom Selbstbewusstsein, das Siedler und ihre Genossenschaften allein deshalb entwickeln, weil sie mit Recht das Gefühl haben dürfen, ihr Geschick selbst in die Hand genommen zu haben. Emanzipation ist zwar allenthalben ein hoch gepriesenes Gut, das politische Parteien freilich lieber für andere fordern, als es in den eigenen Reihen zu leben.
So wird es kein Zufall sein, dass Bürgermeister Seitz erst dann die Reise über die Donau antritt, als im rathausfernen Kagran die neue Wiener Wohnkultur nicht nur am Beispiel einer (alsbald international viel beachteten) „Gartenvorstadt“ zu loben ist. Im Mai 1927 stehen dort nebst der Siedlung „Am Freihof“ auch zwei – im Übrigen eher mediokre – Gemeindebaukasernen zur Eröffnung an. Und dass Seitz bei nämlicher Gelegenheit den skizzierten wohnbauprogrammatischen Konflikt gewandt in Abrede stellt, bestätigt nur dessen Existenz.
Immerhin ist der Stadt die Eröffnung der Freihofsiedlung eine reich illustrierte Broschüre wert, in der neben dem Leiter des Siedlungsamts vor allem der Gestalter der Anlage zu Wort kommt: der Architekt Karl Schartelmüller, Wiener des Jahrgangs 1884 und seit 1913 in Diensten der Stadt. Und nicht nur die Anlage von Straßen und Plätzen, Grundrisstypen für die Häuser samt innerer und äußerer Erschließungsstruktur hat er vorgesehen, sondern selbstverständlich auch, wie die jeweilige Gartenfläche bestmöglich zu nutzen sei: „Für die Anlage der Hausgärten wurden Typenpläne entworfen und die Baumpflanzung einheitlich durchgeführt, um die rationelle Bodenverwertung zu ermöglichen und einen einheitlichen Eindruck der zwischen den Hauszeilen liegenden Gartenflächen zu erreichen.“
Die dazu passenden Fotografien der Broschüre zeigen blühende Obstbäume, niedrige Maschendrahtzäune, Ribisel- und Stachelbeerstauden. Was sie nicht zeigen, weiß meine Erinnerung: ausbetonierte Mistgruben, die neben Gartenabfällen wohl auch die Einstreu aufnehmen sollen, die der jedem Haus eigene Kleintierstall abwirft. Alles im Dienst einer Kreislaufwirtschaft, die sich weitestmöglich selbst genug ist. So sieht sie aus, die Siedlungsgartenwelt, in die jener Marillenbaum gesetzt wird, der mich später durchs Leben begleitet. Gepflanzt muss er irgendwann Ende der Zwanzigerjahre worden sein, wann genau, ist nicht überliefert, nur dass der Baum in den Vierzigerjahren kräftig genug war, einen Halbwüchsigen zu tragen. Etliche Jahrzehnte später hat mir jener, einer der Vorbewohner meines Siedlungshauses, davon berichtet. Und dass er die Pracht der Marillenblüte nie vergessen habe. Wie sie auch mir in Erinnerung bleiben wird.
Meiner eigenen Kindheit, einer in den Sechzigerjahren, ist der Marillenbaum stets als uralt begegnet, ein Stück selbstverständliches arboretrisches Garteninventar, das aus grauer Vorzeit auf uns gekommen schien. Nicht weiter erstaunlich, wie viel an Wandel hatte die Zeit mit sich gebracht, die er bis dahin durchmessen, viel mehr, als es der bloßen Zahl der Jahre gebührend gewesen wäre. 1929 Börsenkrach, 1934 Bürgerkrieg, 1938 Machtübernahme der Nationalsozialisten, anschließend Krieg, danach Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, all das schien sich auf die eine oder andere Art in die Schrunden und Klüfte der Rinde eingeschrieben zu haben, wie es sich auch bei den Bewohnern der Siedlungshäuser rundum niederschlug.
Ungenannt die Zahl der Arbeitslosen unter den Siedlern, die während der Weltwirtschaftskrise abermals auf ihren kleinen Garten als wichtigste Quelle der Nahrung zurückgeworfen waren. Ungenannt auch die Zahl unter ihnen, die auf diesem so sozialdemokratisch geprägten Terrain Opfer des Austrofaschismus wurden. Nicht einmal die Zahl jener jüdischen Siedler ist bekannt, die mit „Anschluss“ und regimetreuer Gleichschaltung der Genossenschaft vertrieben wurden. Aktenkundig nur der Fall eines Ehepaars namens Weiss, das, wohnhaft in einem Siedlungshaus gleich gegenüber jenem, das ich selbst heute bewohne, während der Novemberpogrome des Jahrs 1938 von anderen Siedlern auf die Straße geprügelt wurde.
Drei Jahre später weiß die „Illustrierte Kronen-Zeitung“ wortreich vom Geist zu schwärmen, „der Heimat und Front zusammenschmiedet“. Der Anlass: Die „braven Siedler“ der Freihofsiedlung haben verwundeten Soldaten eines Lazaretts „3500 Prachtäpfel“ gespendet, „von denen manche bis zu 50 Dekagramm wogen“, weiters „1500 herrliche Birnen, 30 Kilogramm Weintrauben“ sowie „126 Gläser Dunstobst“. Siedlungsgärtnerei im Dienst der Wehrkraftwiederherstellung. Wie viele Siedler im selben Krieg fielen, ist nicht überliefert.
Karl Schartelmüller übrigens, noch immer im städtischen Dienst, steuert 1939 dem großdeutschen Wien eine Erweiterung seiner Freihofsiedlung bei – und wird drei Jahre später zwangspensioniert: ob aufgrund seiner ungebrochen sozialdemokratischen Gesinnung oder der beharrlichen Weigerung, sich von seiner Frau zu trennen, die nach den Nürnberger Rassegesetzen als „Halbjüdin“ gilt, ist nicht mehr zu eruieren. Schartelmüller stirbt 1947. In ihrem kleinen Nachruf nennt ihn die Tageszeitung „Neues Österreich“ knapp „einen der hervorragendsten Siedlungsarchitekten“.
Seit Tagen nun schaue ich, da ich diese Zeilen schreibe, auf die Leerstelle in meinem Garten, die mein Marillenbaum hinterlassen hat. Und ich denke an die vielen anderen Leerstellen, geschlagen vom Fortgang der Zeiten, in der Freihofsiedlung wie anderswo im Städtischen. Ich denke an die verschiedenen Läden, die sich bis in die Siebziger-, Achtzigerjahre rund um den Platz in der Siedlungsmitte sammelten, das schmale Papiergeschäft der zarten Frau Hofbauer, den kleinen Fleischer daneben, die Konsumfiliale, das Geschäft mit dem Nähzugehör, die Drogerie der Frau Krückl und die Milchfrau, die Kraft hieß und Stärke vermittelte. Nichts davon hat sich erhalten, der Platz, einst Versorgungszentrum, das die Freihofsiedlung zum autonomen Dorf in der Stadt wachsen ließ, ist ganz Gewerben anheim gegeben, von denen wir seit Kurzem wissen, dass man sie fachsprachlich körpernahe Dienstleistungen nennt: Friseuren, Friseusen und anderer Körperpflegerei. Als kreiste ein Siedlerleben nur mehr um den eigenen äußeren Schein.
Auch sonst ließen sich viele sentimentale oder womöglich düstere Gedanken auf die Verluste verschwenden, die doch jede Veränderung unvermeidlich mit sich bringt. Wie es geschehen konnte, dass wir den Kleinhandel in den Untergang trieben, dass je mehr Geld wir hatten, wir nur umso dringlicher den Billig!-Verheißungen der Diskonter hinterherliefen, je mehr Freizeit wir hatten, nur umso störrischer, nicht zuletzt um Zeit zu sparen, unseren täglichen Einkauf in anonymen Supermärkten zentralisierten, statt ihn zur Begegnung zu nutzen.
Und was würde der gestrenge Herr Loos zu all den Thujenhecken, den verzweifelt von jedem Kräutlein befreiten Rasenmonokulturen, den geschniegelten Blumenrabatten und Rosenäckern sagen, die seine Nutzgartenregel längst außer Kraft gesetzt haben, als hätte es sie ohnehin nie gegeben? Ein letztes Stück, das noch dieser Regel gehorchte, ist vergangenen Montag gefallen, knapp nach acht in der Früh. Eine Pilzkrankheit, die den freundlichen Namen Monilia trägt, hatte meinem alten Marillenbaum von Jahr zu Jahr mehr zugesetzt, trotz aller Interventionen, ihn vor weiterer Unbill zu schützen. Zuletzt hatte sich auch ein Baumschwamm in seine Rinde gefressen, und fast hätte man glauben können, der Baum sage selbst: Es ist genug.
Vergangenen Montag hat er Platz gemacht für ein Neues, von dem noch keiner weiß, was es werden soll. Nur dass es anders wird, als es damals gewesen. Und wie nicht, sind doch auch die Nöte und Notwendigkeiten, die uns plagen, nicht mehr dieselben. Genauso wie uns heute in unseren Breiten die Sorge vor dem Verhungern nicht mehr umtreiben muss, wären ja andererseits die wenigsten von uns noch dazu befähigt, Hühner und Ziegen zu halten oder mit eigener Hände Arbeit ein Siedlungshaus zu erbauen. Und keiner kann wachen Sinnes wünschen, dass es wieder werde wie damals, als solches allgemeiner Wissensstand war, jedenfalls unter jenen, die sich dem Siedlungsgedanken verschrieben.
Zahllose Transformationen hat die Freihofsiedlung erfahren, manche wohl auch erlitten. Und wenn Architekturconnaisseure sich nach Kagran verirren, hört man oft die Klage, was da alles an Zu- und Umbauten mittlerweile geschehen sei. Ich schaue auf die Leerstelle in meinem Garten, sehe Verlust und unvermutete Möglichkeit. Es war gut, wie es war, und aller Erfahrungen nach wird’s bald wieder so sein, als wär’s immer so, wie’s dann sein wird, gewesen.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 6. Februar 2021.