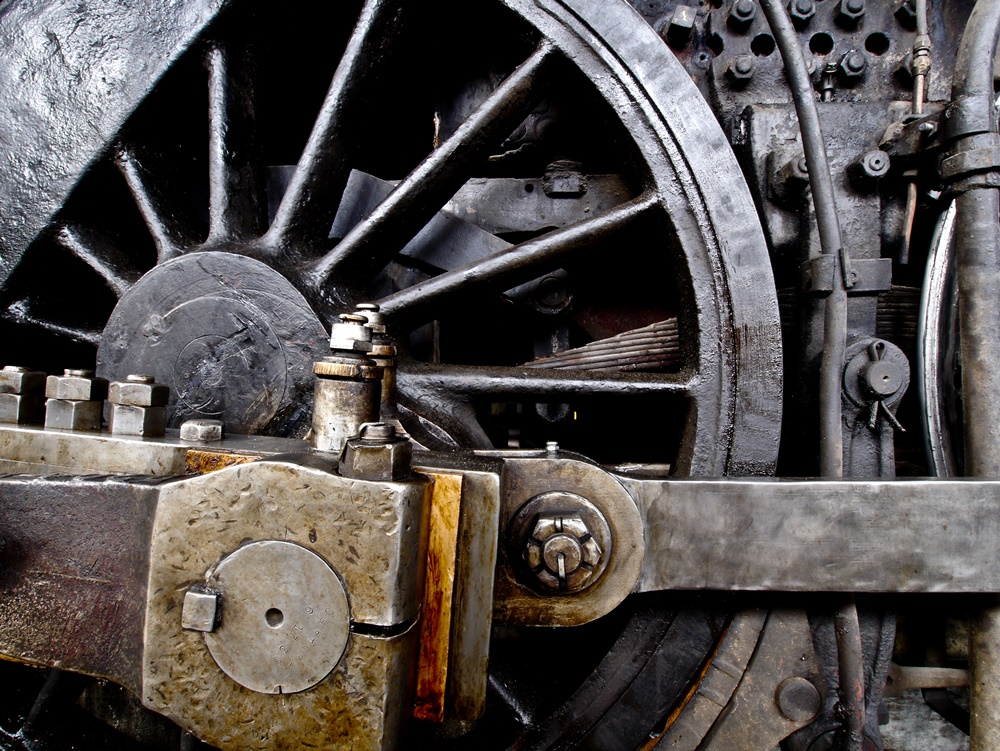Wie österreichisch ist der Fleischhauer? Und wie deutschländisch der Metzger? Wo fängt die Ribisel an – und wo hört sie auf? Was ist das Österreichische am österreichischen Deutsch? Und wovor müssen wir es schützen? Versuch einer Aufklärung.
Kennen Sie den? „Dåo is da Fåådar – amul mit-n glååan Puim schpå ziian aaosiggaonga af-d Föölda.“ Oder den? „Ååamål am an Ååbat, ischt nu a eeinziga Wirtschaft im Ggargelle gsii, so a Schnapshüüsli, sent dia Buura all binan khocket.“ Zwischen beiden Wortspenden, hier angenähert in Schrift wiedergegeben, liegen nur wenige Jahre, dafür etliche hundert Kilometer Luftlinie – und eine Sprachgrenze, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt: die zwischen bairischen und alemannischen Dialekten. Und auch wenn wir uns einigermaßen gewiss sind, dass der erstzitierte Landwirt aus dem burgenländischen Oberschützen und der zweitzitierte Postbeamte aus dem Vorarlberger Sankt Gallenkirchen bei einer etwaigen Begegnung erhebliche Verständigungsschwierigkeiten hätten, zögern wir im Allgemeinen nicht lange, ihr Deutsch als „österreichisch“ kenntlich zu machen. Motto: Österreichisch ist alles, was in Österreich ist.
Je nun, Sprache (wie viele andere Parameter der Zivilisation) hat die unangenehme Eigenschaft, sich nicht an Staatsgrenzen zu halten. Und das betrifft keineswegs nur Dialekte (obige Beispiele sind übrigens der von Wilfried Schabus verantworteten, akribisch dokumentierten CD „,Dazähl’n‘ – 100 Jahre Dialektaufnahme in Österreich“ entnommen). Auch in dem, was als schriftsprachlich wahrgenommen wird, ist nicht alles total österreichglobal, was man gerne dafür ausgibt. So finden wir den im heimischen Osten als besonders deutsch-deutsch verschrienen „Metzger“ problemlos – und ohne jedwede usurpatorische Einflüsse vom großen Sprachbruder – in westlichen Bundesländern; und auch die Ribisel verliert sich irgendwo hinter der Enns, um als Johannisbeere wiederzuerstehen. Das nicht weniger oft als landestypisch vorgeführte Obers ist selbst in rotweißroten Schranken gegenüber dem altgedienten Rahm seit je ein Minderheitenprogramm; und sogar mit unserem gewohnten Tischler hat’s spätestens am Arlberg ein End – ab da ist er als Schreiner geläufig. Dafür begegnen wir ihm andererseits bis ins nordisch Holsteinische hinauf – da soll sich noch einer auskennen.
Wir sehen: Die Sache mit der Sprache ist einigermaßen verwickelt und taugt so ganz und gar nicht zur Munition im Kampf um gesamtstaatliche Identität. Entweder man greift zu kurz und punziert als österreichisch, was bestenfalls teilösterreichisch ist – oder man greift zu weit und holt nolens volens jene ins vermeintlich eigene Boot, von denen man sich gerade abgrenzen will. Doch weil nichts so fruchtbar als Basis für üppige Kulturdebatten ist wie vollkommene Unwissenheit, gibt jeder seinen Senf dazu. Motto: Wehret dem Mostrich!
„Die Frage nach dem typisch ,Österreichischen‘ gewann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Neuorientierung der Republik Österreich an Aktualität“, schreibt Herbert Fussy im Geleitwort zu seinem Band „Auf gut Österreichisch“. „Inzwischen hat das österreichische Deutsch längst seinen Stellenwert als eine Varietät unter mehreren im Deutschen.“ Wenngleich die Sache einen Haken hat: „Was alles ein Austriazismus ist, kann linguistisch nicht immer eindeutig abgegrenzt werden.“ Ja, schlimmer noch: „Die Zahl der Ausdrücke, die in ihrer Verbreitung streng genommen wirklich nur auf das österreichische Staatsgebiet beschränkt sind, ist bei weitem nicht so groß wie die Zahl der Ausdrücke, die die Staatsgrenzen überschreiten.“ Und außerdem und überhaupt ist „vieles auch innerhalb Österreichs regional“. Kurz: „Der österreichische und der andere deutsche Wortschatz sind bildlich gesprochen selten ein Kontrast von Schwarz und Weiß, sondern öfter eben nur ein Kontinuum von Dunkel- bis Hellgrau.“ Und was bitte ist dann in dieser grau-in-grauen Komposition das so spezifisch Österreichische am österreichischen Deutsch?
Immerhin, Fussy weiß sich zu helfen. Wenn er uns lexikalisch vorführt, was der eine oder andere „gut österreichische“ Terminus bedeutet, so versieht er seine auserwählten Stichworte meist mit Zusätzen wie „bes. ostöst.“ oder „regional“ respektive „auch süddt.“ oder „lokal in D“. Was ihn freilich dazu antreibt, solche editorische Redlichkeit fallweise beiseite zu lassen, ist schwer zu ergründen. So kommt etwa die oberwähnte Ribisel anmerkungslos daher, als könnte man ihr von Kittsee bis Lochau begegnen. Die gute alte Schmierage wiederum, immerhin dem Duden-Wörterbuch der österreichischen Besonderheiten, „Wie sagt man in Österreich?“, geläufig, sucht man vergeblich; aber vielleicht ist die Fussy nicht gut oder nicht österreichisch genug.
Wenigstens erspart es uns Fussy, das Bewusstsein dafür stärken zu wollen, dass es sich beim österreichischen Deutsch „um eine nationale Variante der deutschen Standardsprache“ handle, worum es Rudolf Muhr mit seiner Homepage „Österreichisches Deutsch“ zu tun ist, eingerichtet am Institut für Germanistik der Grazer Universität. Ein Ansinnen, das schon am beigefügten Sprachquiz scheitert: Da finden wir wieder die notorisch angeblich österreichweite Ribisel, detto den Rauchfang, der gleichfalls schon in Westösterreich – zu Gunsten des Kamins – entschwindet, oder das Parterre, das so typisch rotweißrot ist, wie es seine massenhafte Verbreitung in – sagen wir – Berlin gerade noch zulässt.
Ach ja: „Nicht immer ist es so, dass die als ,österreichisch/deutschländisch‘ angegebenen Ausdrücke ausschließlich in Österreich/Deutschland vorkommen.“ Wenn es aber auch nicht immer so ist, dass die als „österreichisch“ angegebenen Ausdrücke wenigstens in ganz Österreich vorkommen: Was bleibt dann noch von einem nationalsprachlichen Anspruch?
Die Konzentration auf eine Art gesamtstaatlicher Standardsprache zwischen Neusiedler und Bodensee, einen gemeinsamen Sprachnenner, der naturgemäß klein sein muss, lenkt seit Jahr und Tag den Blick davon ab, was tatsächlich eine singuläre, sehr spezifische Qualität der hiesigen Szenerie ist: die auf kleinstem Raum so faszinierend vielfältige Gemengelage aus Wortschätzen und Tonfällen, die wir nicht zuletzt dem Umstand verdanken, in einem Land zwischen so vielen und so unterschiedlichen Sprachen zu leben. Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Kroatisch, Slowenisch, Italienisch, nicht zu vergessen das Jiddische oder lokale Spezialitäten wie das Ladinische und das Rätoromanische – sie alle wirken seit Jahrhunderten in unterschiedlichster Weise und unterschiedlichster Intensität auf unser Vokabular und unsere Sprachfärbung ein, haben eine Sprache entstehen lassen, deren Reichtum nicht in der Homogenität, sondern in der Widersprüchlichkeit liegt – und die sich gerade deshalb jeder Standardisierung widersetzt.
Umso kurioser, wenn Sprachschützer aufmarschieren, um vermeintlich kanonisiertes heimisches Sprachgut gegen die bösen Einflüsse aus der nicht minder bösen weiten – will sagen: außerösterreichischen – Welt zu verteidigen. Wenn’s solchermaßen ans sprachnational Eingemachte geht, da kann es schon passieren, dass man sich im Kampf gegen eine – pfui! – fremdländische Konfitüre für eine nicht minder fremdländische Marmelade in die Bresche wirft. Tröstlich zu wissen, dass sich ein Zuagraster, ist er nur lang genug geblieben, sogar hierzulande irgendwann als Hiesiger, ja, als unverzichtbar zur eignen Sprachethnie gehörig fühlen darf; doch warum sollte das nicht genauso gut für andere, für heutige Neuankömmlinge gelten können?
Dass Sprache nicht ein Zustand, sondern ständig „work in progress“ ist, dass Sprachgutsammlungen welcher Art immer stets nur Momentaufnahmen, aber niemals Codices sind, die ewig gültige Festschreibungen treffen, sollte eigentlich Gemeingut sein. Macht man sie zu Bollwerken eines sakrosankten Status quo, missversteht man nicht nur schlichtweg ihre Funktion, schlimmer noch – man erstickt, was man retten zu müssen vorgibt: Denn Stillstand bedeutet – auch in der Sprache – Tod.
Werfen wir einen Blick auf die mitunter wüst verflochtene und nicht selten auswärtige Genese so vieler heute als besonders inwärtig empfundener Termini, wie sie uns Sigmar Grüner, assistiert von Robert Sedlaczek, in seinem „Lexikon der Sprachirrtümer Österreichs“ vorführt: So geht unser schönes, ach so typisch österreichisches „Abschasseln“ auf das französische „chasser“ (jagen) zurück, unser nicht weniger schönes und auch nicht weniger typisch österreichisches „Ausstallieren“ auf das italienische „scagliare“ (werfen, Vorwürfe machen). Das vermeintlich neumodisch importierte „Ciao“ ist hierzulande seit gut 150 Jahren belegt, als es österreichische Soldaten nach Niederschlagung der italienischen 1848er-Revolution aus Lombardo-Venetien mitbrachten, und stellt seinerseits wiederum „wahrscheinlich eine Lehnübersetzung des im deutschen Österreich üblichen ,Servus‘“ dar. Das im Übrigen als Gruß nicht sehr viel älter sein dürfte als sein italienisches Pendant.
Besonders erhellend die Beispiele, wo sich bodenständiges Sprachgut fremdsprachlich maskierte: wie etwa bei der schon erwähnten „Schmierage“ oder der „Fressage“, die nichts, aber schon gar nichts mit dem durch die Endung „-age“ nahegelegten Französisch zu tun haben. Auch so Wohlvertrautes und so scheinbar verlässlich der Fremde Entnommenes wie Installateur, Friseur oder Billeteur ist erst auf deutschsprachigem Boden entstanden.
Grüners Beweisführungen sind mitunter geläufig, dann wieder völlig neu und in ihrer Stringenz verblüffend. Zumindest in einem Fall freilich auch ein wenig zu verwegen: wenn er den wienerischen „Teschek“ (für Ausgenützter, Benachteiligter) nicht wie üblich vom ungarischen „tessék“ (bitte), sondern von einem tschechischen „tezký“ (schwer, mit Mühe) herleitet – und als „missing link“ seiner brüchigen Argumentation nur die Aussage einer zufällig belauschten Waldviertlerin in einer fidelen Kartenrunde anzubieten hat.
Halten wir fest: Sprachmoden kommen und gehen, Brüsseler und andere Vokabular-Diktate auch. Mit dem Geschick dessen, was wir das österreichische Deutsch nennen, hat beides nicht viel zu schaffen. Das entscheidet sich nämlich vor allem darin, ob unsere oft bemühten lokalen Sprachtraditionen gelebt werden – oder nur museale Versatzstücke sind. Wenn wir Sammlungen wie Ernst Webers „1500 Gstanzln aus Wien und Umgebung“ nicht als rein historisches Dokument, sondern als Anregung für Künftiges begreifen, dann kann uns jeder Konfitüre-Marmelade-Disput genau genommen Wurst sein.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 7. Februar 2004