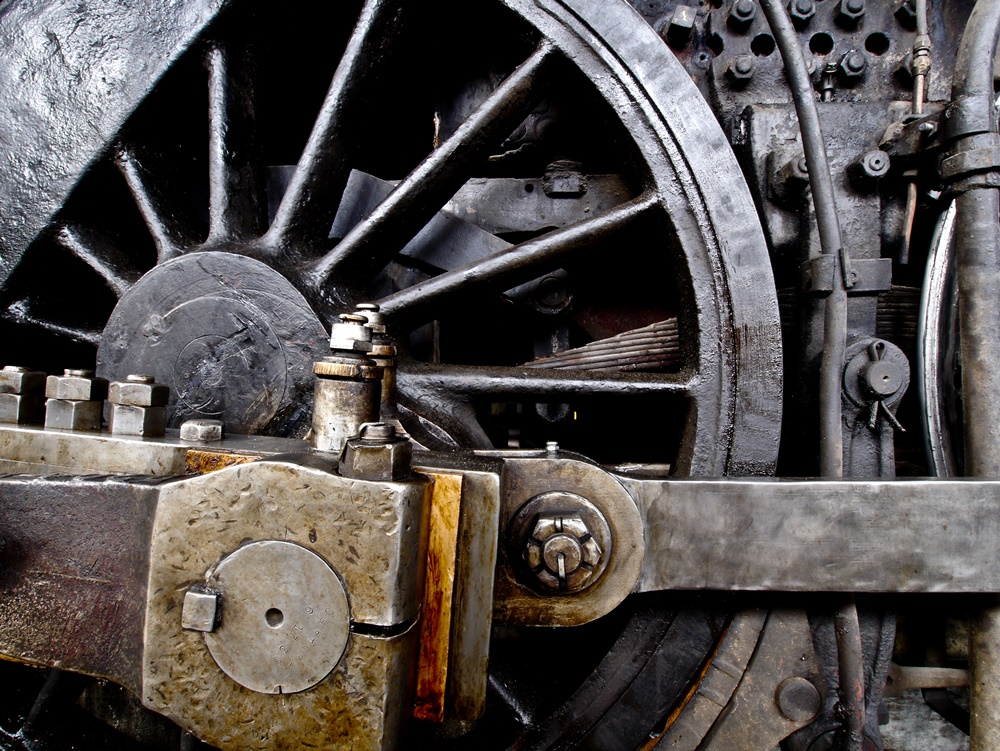Was von seiner Ära bleiben soll? „Rufen Sie mich am 31. August 2011 an.“ Jürgen Flimm über seine erste Saison als Intendant der Salzburger Festspiele, das Erbsenzählen, rostige Kähne und die Lust des Protestanten an üppigen Kirchen.
Herr Flimm, wenn ich mir Ihr Intendantenbüro anschaue, dann ist die Anmutung ziemlich unin tendantisch: Da haben wir ein zerschlissenes Sofa, zwei alte Theatersessel, ein Regal Typus Ikea, eine Schreibtischplatte auf simplen Böcken, verschämt an die Wand gerückt – alles wirkt improvisiert, wie auf der Durchreise – und nicht so, als würden Sie bis 2011 hier bleiben wollen.
Das kann ich erklären: Erst einmal bin ich ein Gegner von Schreibtischen, die den Raum trennen. Ein Schreibtisch ist ja etwas für mich, also steht er in allen meinen Büros immer an der Wand, und ich schaue aus dem Fenster. Das ist mir einfach angenehmer. Ich bin ein Intendant, der sehr viel mit Leuten reden muss, ich kann das nicht alleine, da fällt mir gar nichts ein. Also habe ich hier sehr oft große Sitzungen, da sind 20 Leute hier, deshalb muss sehr viel Platz sein.
Das Sofa, auf dem ich sitze, ist das Sofa aus meiner allerersten Salzburger Inszenierung, 1987, „Der Bauer als Millionär“, kunstzerschlissen, das hat der Bühnenbildner mit Bedacht getan. Die beiden Theatersessel sind aus dem Kleinen Festspielhaus, die hab‘ ich neulich hier auf dem Gang stehen gesehen, hab‘ gesagt, tut mir die doch ins Büro, mittlerweile sind das schon die beliebtesten Plätze.
Das ist mein Büro, ein Arbeitsraum, kein Wohnzimmer.
Es geht die Sage, Sie bevorzugen endlose Besprechungen.
Gespräche. Ich bevorzuge, mit vielen Leuten zu reden. Immer, wenn wir können, treffen wir uns, Thomas Oberender vom Schauspiel, Markus Hinterhäuser vom Konzert, Evamaria Wieser, unsere künstlerische Betriebsdirektorin, und ich, wir sitzen im kleinen Kreis und fangen an, uns an 2008, 2009 heranzutasten. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann: Ich beschließe das jetzt und fertig; außerdem wird man durch andere klüger. Theater ist Kommunikation, von der Bühne zum Zuschauerraum, aber wir müssen auch untereinander gut kommunizieren.
Sie sind seit rund vier Jahrzehnten mit der Bühne verbunden, Sie haben als Intendant und Regisseur alles erreicht, was man in diesem Metier erreichen kann, im vergangenen Jahr sind Sie 65 geworden, das ist ein Alter, in dem sich üblicherweise die werktätige Bevölkerung zur Ruhe setzt. Und genau in diesem Alter hängen Sie sich etwas um wie die Salzburger Festspiele: Warum um alles in der Welt tun Sie sich das an?
Wieso sagen Sie, ich tue mir etwas an? Es ist ja schön, in Salzburg zu arbeiten, es macht großen Spaß. Ein wunderbarer Ort.
Großen Spaß könnten Sie auch als freier Regisseur haben, Sie könnten machen, was Sie wollen und wo Sie es wollen, und wären dabei wesentlich weniger gebunden als jetzt, wo Sie diesen riesigen Kahn durch die Kulturlandschaft ziehen.
Der Kahn ist riesig, aber es ist ja ein sehr schöner Kahn, das ist kein rostiger Kahn, es ist kein Kahn, der ein Leck hat, er fährt auf einem wunderbaren Fluss, warum soll man sich da nicht auf die Kommandobrücke stellen? Man muss nur wissen, dass man das nicht allein bewegen kann.
Gehen wir 40 Jahre zurück. Da gab es Ihre Anfängerjahre an den Münchner Kammerspielen, gemeinsam mit Ihnen waren auch ein junger Peter Stein oder ein junger Claus Peymann dort. Jetzt, 40 Jahre später, fällt Peter Stein vor allem mit Monumentalproduktionen und grantigen Spitzen gegen das Theater der Gegenwart auf, Peymann keppelt über seinen einstigen Lieblingshelden Voss und der zurück, und Sie sind in eine Position gekommen, die den jungen Wilden von damals wie der Gottseibeiuns persönlich erschienen wäre. Was hätte Jürgen Flimm um 1968 über einen Jürgen Flimm gesagt, der Salzburger Festspielintendant ist?
1968 waren die Salzburger Festspiele für mich so weit weg wie die Erde vom Mond, das war irgendwo, ich hatte gar keinen Begriff davon. Da hatte ich vor allem mit mir viel zu tun, ich musste mich erst in den Beruf hineindenken und -arbeiten. Die Frage war, ob ich das überhaupt kann. Da gab es auch Krisen. Ich habe bei Fritz Kortner assistiert, da hat man die Härte des Berufs kennengelernt. Ich habe bei Hans Schweikart assistiert, da hat man die Schönheit des Berufs kennengelernt, beides grandiose Regisseure. Salzburg war für mich nicht existent.
Weit weg, aber kein Feindbild?
Feindbild wurde es ein bisserl später. Das war auch herbeigeschrieben, das Feindbild Karajan. Ich hab‘ dann, als ich das erste Mal hierherkam, 1987, mich in einer Sekunde verliebt in die Stadt. Das war ein ganz ungeahntes Gefühl für mich, so zu arbeiten, in schöner Umgebung, mit diesen tollen Leuten, das war nicht mehr dieses Ackern, Büro, Produktion, Produktion, Produktion, ich hab‘ eine ganz eigenartige Freiheit verspürt. Deshalb ist diese Inszenierung wahrscheinlich auch so gut geworden, „Der Bauer als Millionär“, auf dessen Sofa ich hier sitze, das war sicherlich eine meiner besten Aufführungen. Und ab da war ich immer scharf darauf, hier zu arbeiten.
Was soll von der Ära Flimm bleiben?
Darüber will ich jetzt gar nicht debattieren. Ich hab‘ ja nicht einmal die erste Saison heil hinter mich gebracht . . .
Aber Sie haben ja schon genug Salzburg-Erfahrung.
Ich denke doch nicht ans Geschichtsbuch, ich denke, dass ich jeden Tag meine Arbeit machen muss. Und dass ich erst einmal den Sommer überstehen muss. Und hoffentlich ein paar gute Produktionen vorweisen kann. Aber was 2011 sein wird? Rufen Sie mich am 31. August 2011 an, dann sag‘ ich Ihnen das.
Es ist ja nicht gesagt, dass dann Ihre Ära zu Ende ist.
Doch, schon. Da bin ich 70.
Also mit 65 kein Pensionist, mit 70 schon?
Ganz zu Ende wird es damit auch nicht sein. Da kann man ja noch Bücher schreiben, das mach‘ ich sicherlich, es gibt die Möglichkeit, dass man unterrichtet, das mach‘ ich sicher auch, es gibt die Möglichkeit, dass man einmal ein halbes Jahr nach New York geht und da arbeitet. Ich werde mich sicher nicht mit 70 auf meine Wiese setzen und die Erbsen zählen. Irgendwas ergibt sich ja immer.
Wie wichtig ist für einen Tourismusgroßbetrieb wie die Salzburger Festspiele überhaupt, was jeden Abend auf der Bühne passiert? Geht es da nicht mehr um Images als um ästhetische Kategorien?
Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich sage, das, was auf der Bühne passiert, ist das Zentrum. Alles andere ordnet sich dem nach. Das ist aber in jedem Stadttheater so. Immer, wenn ich ein Theater übernommen habe, habe ich die Rede gehalten: Die Bühne ist der Magnet, wie Eisenspäne rundherum richtet sich alles nach diesem Magneten. Und wenn man dieses Gefühl nicht hat, wenn man das nicht weiß, dann wird man scheitern. Das ist auch hier völlig klar, wir haben hoch motivierte Mitarbeiter. Bis zum letzten Schweißtropfen wird hier geschuftet. Und wenn wir das verlieren, wenn wir sagen, es ist wichtiger, wie viele Autos hier durch die Hofstallgasse fahren, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Jedes Dorffestival würde uns den Rang ablaufen.
Ich nehme an, die Mitarbeiter beispielsweise an der Wiener Staatsoper sind nicht weniger motiviert.
Ja, das weiß ich, die sind sehr motiviert. Aber bei uns ist das ein bisserl anders. Die Energie ist auf diese fünf Wochen fokussiert, und das ganze Jahr werden diese fünf Wochen trainiert. Und wir wissen, wenn die fünf Wochen kommen, wenn die Proben kommen, dann muss die Energie umgesetzt werden, das ist eine ganz andere Geschichte als in einem Repertoirebetrieb. Da sind sie in einem anderen Takt drinnen. Hier bei uns, das ist wie Standgas: Sie stehen da und machen brumm, brumm, brumm – und dann geht’s los. Sie müssen in sechs Sekunden von null auf hundert sein. Diese Konzentration müssen Sie das ganze Jahr trainieren. Die Leute fragen immer: Was machen die außerhalb der Festspielzeit? Es hat ja kaum einer Ahnung, wie hier das ganze Jahr hindurch gearbeitet wird.
Und wodurch wollen Sie sich von anderen Festivals unterscheiden, von Edinburgh, Avignon, Aix-en-Provence? Was ist das Unverwechselbare an den Salzburger Festspielen?
Dass wir den allumfassenden Begriff haben. Wir haben den Begriff Theater und Lesungen und Konzerte und Solokonzerte und Opernaufführungen und Schauspielaufführungen; wenn Sie die Festspiellandschaft anschauen, das gibt es nirgendwo in diesem großen Zusammenhang, wir haben den allumfassenden Anspruch im Rahmen der Performing Arts. Es gibt kein Festival der Welt, das das anbietet. Mehr geht nicht.
Also das Singuläre der Salzburger Festspiele liegt darin, ein besonders großes Großkaufhaus der darstellenden Kunst zu sein.
Nein, das ist kein Kaufhaus, ein Kaufhaus ist ja leblos, da können Sie eine Hose kaufen, und dann haben Sie sie so lange an, bis Sie sie wegschmeißen. Bei uns können Sie das nur einmal erleben. Dann erleben Sie es ja nie mehr. Sie gehen hin, Sie schauen sich das an – und Sie haben es nur mehr in der Erinnerung. Das ist schön.
Nehmen wir das aktuelle Programm: Wie hat man sich sein Zustandekommen konkret vorzustellen? Sie haben da ein Motto, „Nachtseite der Vernunft“, aber was ist in Wirklichkeit zuerst da: eine Reihe bestimmter Sänger, bestimmter Regisseure, fragt man die, was wollt ihr machen, und dann hängt man ein Motto oben drüber, oder gibt es zuerst eine Programmidee, und dann sucht man sich die Leute dazu?
Das kann man so nicht sagen. Das ist nicht eine Abfolge, die man festschreiben kann, daran verzweifelt jeder Unternehmensberater. Hier war ja auch einmal einer, da habe ich gesagt: Sie können gleich wieder nach Hause gehen, Sie kriegen das hier nicht in ein System.
Aber irgendwie muss auch dieses Nichtsystem funktionieren.
Immer wieder durch Gespräche. Parallel zur Entwicklung der Programmidee redet man mit Regisseuren, parallel dazu redet man mit Dirigenten. Es gibt keine Kategorien, wie man das macht. Manchmal ist das Ei zuerst da, manchmal die Henne, manchmal muss man warten, bis das Ei ausgebrütet ist und eine Henne ausschlüpft.
Der Außenstehende jedenfalls sitzt mit einem Programm und einem programmatischen Motto da und fragt sich, wie das eine zum anderen kommt. Statt „Eugen Onegin“ beispielsweise hätte man mit selber Berechtigung etwas ganz anderes ansetzen können, ich vermute, gut drei Viertel der Opernliteratur stehen im Zeichen der Unvernunft. Wie vernünftig sind Othello, Tosca, Isolde?
Ja, das ist natürlich immer ein enger Ausschnitt. Ich kann Ihnen über jede Produktion eine andere Geschichte erzählen. Einer der Gründe, Haydns „Armida“ anzusetzen, war zum Beispiel, dass dieser wunderbare Opernkomponist Haydn in seinem Heimatland immer mit der Mozart-Bürste weggefegt wird, das ist Unkenntnis. Also hab‘ ich gesagt: Haydn.
Und das nächste Haydn-Jahr steht ja auch vor der Tür.
Das interessiert doch nicht. Ich bin kein Quiz-Intendant.
Wie wär’s mit allen Haydn-Opern zum Haydn-Jahr 2009?
Oder im nächsten Händel-Jahr alle Händel-Opern? Das sind, glaube ich, 46.
Womit wir noch einmal an der Nachtseite der Vernunft wären. Das Thema ist ja schon allein durch die Debatten rund um die Rückkehr des Religiösen oder „Intelligent Design“ aktuell. Wir leben doch in einer Zeit, in der man eher vor zu wenig denn vor zu viel Vernunft warnen müsste.
Ich meine, wir kommen mit unserer Vernunft immer öfter an Grenzen. Vernunft ist ja gut, Vernunft klärt auf, Vernunft macht uns frei, das wissen wir alles, und dann schauen wir uns die Französische Revolution an, geboren aus der Aufklärung, und wissen, wo das endet. Es hat immer die Schattenseiten gegeben, und es hat immer das Unerklärbare gegeben. Deshalb mag ich „Freischütz“ so gerne, da ist wirklich die Schwärze der deutschen Seele. Die Wiener haben uns den Herrn Freud geschenkt, der hat das alles genauestens beschrieben, das ist ein absolut zentrales Thema, das wir ja nur berühren mit unseren paar Stücken.
Denken Sie einmal an die Kohlendioxid-Debatte: Wir wissen alle, dass das wahrscheinlich, wenn wir uns nicht ändern, in eine Katastrophe münden wird. Und ich fahre immer noch ein dickes Auto. Wir wissen das alles, weil wir vernünftig sind – aber wir leben einfach so weiter wie bisher. Wir kommen mit unserer Vernunft an merkwürdige Grenzen. Und ich habe in meinem Alter noch nicht herausgekriegt, was die Grenze bestimmt. Bestimmte Dinge sind nicht erklärbar. Deshalb gehe ich ganz gerne in die Kirche. Da ist etwas, was mir auch nicht erklärbar ist, was aber auch nicht erklärt werden soll.
Ist es egal, in welche Kirche.
Nein, ich bin überzeugter Protestant, da bestehe ich drauf.
Tun Sie sich da im erzkatholischen Salzburg nicht schwer?
Salzburg schreckt mich nicht, ich bin in Köln aufgewachsen als evangelischer Junge, Salzburg ist eine leichte Übung, wenn man in der katholischsten Stadt Deutschlands aufgewachsen ist. Außerdem habe ich die Kirchen hier alle sehr gerne.
Aber die haben doch etwas sehr Unprotestantisches an sich.
Wir Protestanten haben gerne üppige Kirchen, weil unsere nicht so üppig sind. Das ist doch immer so.
Auch eine Nachtseite?
Ja, eine Nachtseite der protestantischen Vernunft.
Sie waren einmal Schauspielchef hier, sind in Unfrieden aus dieser Position geschieden, nicht zuletzt weil Sie mit der untergeordneten Rolle des Schauspiels unzufrieden waren. Und wenn ich mir jetzt Ihr Programm anschaue, dann ist auch bei Ihnen die Dominanz des Opernbereichs unübersehbar.
Ich bin geschieden, weil ich die Rolle des Schauspiels während des Mozart-Jahres nicht gefunden habe. Ich hatte eine schöne Liste gemacht, aber Peter Ruzicka hat das nicht so interessiert. Und da hab‘ ich gesagt: Gut, da muss ich auch nicht bleiben. Andererseits: Ja, die Oper hat hier Vorrang, einfach weil sie mehr Plätze hat als das Schauspiel. Peter Stein hat das damals schlau gemacht, der hat sich die Felsenreitschule genommen, das ist mir schon nicht mehr gelungen. Dadurch, dass die Platzzahl nicht so groß ist – das ist eine klare Begründung -, geht auch die Aufmerksamkeit weg vom Schauspiel, obwohl Thomas Oberender ein schönes Programm gemacht hat; „Ein Fest für Boris“ anzusetzen, find‘ ich ganz toll, da wäre ich nicht draufgekommen.
Es gibt allerdings nicht nur im aktuellen Festspiel-Programmheft, sondern auch in Ihren eigenen Arbeiten der jüngeren Vergangenheit einen deutlichen Überhang der Opernproduktionen gegenüber dem Sprechtheater.
Das hängt mit der Trennung vom „Thalia Theater“ zusammen, das war hart, ich war einer der wenigen, die das freiwillig aufgegeben haben; ich hatte meine Zeit am „Thalia Theater“ und habe gesagt: Jetzt ist sie auch vorbei. Mein Ensemble war sicherlich eines der besten in Deutschland, die wurden dann gleich abgefischt von Baumbauer und von Bachler, das ist in alle Winde zerstoben. Und wenn Sie 15 Jahre an einem Theater arbeiten, mit denselben Schauspielern, dann gibt es eine Vertrautheit, und es ist schwer, in einem gewissen Alter zu sagen: Ich muss jetzt noch einmal anfangen mit Leuten, die ich gar nicht kenne.
In der Oper ist das anders, da hat man zwischen sich und dem Theater die Musik, das ist ein ganz anderer Weg, sich anzunähern. Mit Schauspielern muss man sehr ungedeckt und sehr blank arbeiten, und ich habe mich vor dem Weg zu den neuen Individuen, zu den neuen Egos gescheut.
Der Sprechtheater-Regisseur Flimm: ein abgeschlossenes Sammelgebiet?
Vielleicht mache ich noch einmal etwas, kurz vor Ende meiner Intendantenzeit in Salzburg werde ich mich bei Thomas Oberender bewerben: Es tut mir leid, ich bin zwar schon Ende 60, aber ich kann den Job immer noch, lass mich bitte eine kleine Inszenierung im Landestheater machen, denn da hab‘ ich angefangen, da möchte ich auch gerne aufhören. Und dann wird dieses kunstzerschlissene Sofa auch auf der Bühne stehen.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 23. Juni 2007