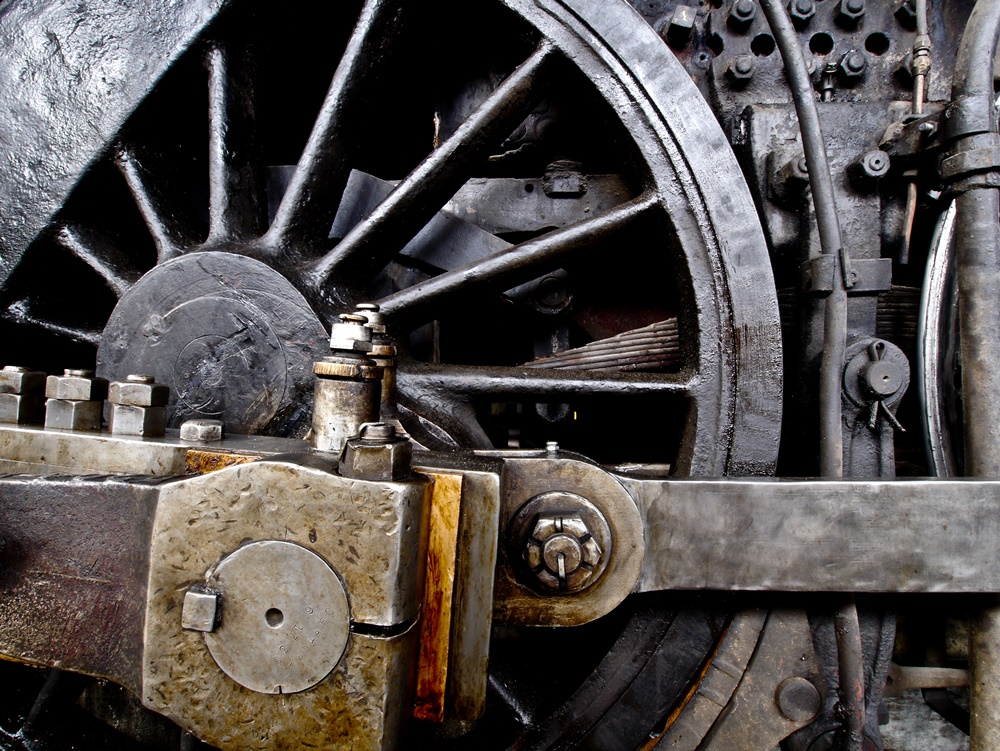Wie ein ganzes KZ verschwindet – und eine unterirdische NS-Fabrik wieder auftaucht. Zur ungeschriebenen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Konzentrationslager von Gusen bei Linz.
Wohnen mit Krematoriumsblick. Sie suchen ein neues Heim in der Nähe von Linz? Wie wäre es zum Beispiel damit: „Wohnanlage in Langenstein. 12 Wohneinheiten 93 bis 130 m². Die Wohnanlage besteht aus 4 Häusern mit jeweils 3 Wohneinheiten. Die offene Raumgestaltung im Erdgeschoß schafft einen großzügigen, hellen Wohnraum. Natürlich sorgt im Bad ein Fenster für Helligkeit und gute Belüftung.“ Und vielleicht sorgt dieses Fenster auch gleich für einen Blick auf das Nachbargrundstück: direkt auf das Krematorium des Konzentrationslagers Gusen I, dorthin, wo der Doppelmuffelofen der Firma Topf & Söhne steht, der hier Anfang 1941 in Betrieb genommen wurde und durch dessen Schornstein in der Folge 30.000 Menschen „flogen“, wie das die KZ-Häftlinge selbst nannten. Trautes Heim, Glück allein, und nebenan die Reste einer der bestfunktionierenden Vernichtungsmaschinen der SS?
Nicht dass Katharina Huemer, bei Huemerbau für die Wohnanlage Langenstein zuständig, das – nun, sagen wir – ein wenig unübliche Umfeld ihres Projekts verschwiege: „Es ist halt eine ein bisserl geschichtsträchtige Gegend, Mauthausen, Gusen, das zieht sich so durch.“ Richtig, das zieht sich so durch hier, östlich von Linz, vom KZ Mauthausen, hoch droben über der Donau, über die Konzentrationslager Gusen I und II ein paar Kilometer weiter im Tal, in der Mauthausener Nachbargemeinde Langenstein, bis zu den Stollen des Nazi-Projekts „Bergkristall“, einer der größten unterirdischen Rüstungsfabriken des Dritten Reichs, abermals ein paar Kilometer weiter, in der Langensteiner Nachbargemeinde Sankt Georgen an der Gusen. Doch während das KZ Mauthausen, weithin sichtbar, zur Gedenkstätte konserviert, seine Geschichte gleichsam demonstrativ vor sich her trägt, verbirgt sie sich in Langenstein und Sankt Georgen unter dicken Schichten von Nachkriegstransformierung: Gusen I und II sind unter schmucken Einfamilienhaussiedlungen verschwunden, „Bergkristall“ liegt ohnehin praktischerweise halbwegs unsichtbar im Berg, und wäre da nicht das Krematorium samt anliegendem KZ-Besucherzentrum, dort nicht ein gesprengter Lüftungsturm des Stollensystems, so gut wie nichts ließe ahnen, was hier vor gar nicht so langer Zeit geschehen ist.
Wir haben ja genug gesehen unterm Krieg, wie sie das KZ gebaut haben in Gusen, haben lauter KZler gebaut, das Gusen-KZ. 13, 14 Jahre war ich, wir sind noch in die Schule gegangen, wie sie in Gusen schon verbrannt haben. Da haben wir’s ja schon geschmeckt, wenn wir auf Sankt Georgen gegangen sind, in der Früh, in die Schule, wie es gestunken hat, wie es herausgeraucht hat, wir haben ja das alles gesehen als Kinder. (Eine Langensteinerin, Jahrgang 1929.)
Der schreckliche Zwilling. Kaum 14 Tage sind seit dem „Anschluss“ vergangen, da kann Gauleiter August Eigruber schon im „Völkischen Beobachter“ verkünden, die Oberösterreicher würden „als besondere Auszeichnung“ ein „Konzentrationslager für die Volksverräter von ganz Österreich“ bekommen. Die Wahl fällt auf den Raum Mauthausen: Hier sind die Steinbrüche zu finden, die man für die hochfliegenden NS-Baupläne dringend braucht. Die SS-eigene Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH, kurz DESt, pachtet, kauft, presst ab, enteignet die Steinbrüche in und um Mauthausen und Langenstein, im Wesentlichen der Stadt Wien und dem ortsansässigen Steinindustriellen Anton Poschacher gehörig, und betreibt sie weiter – mit den politisch, rassisch oder sonst wie nicht Genehmen, die ihr von Gestapo und SS zugetrieben werden. Das Konzept ist simpel: Arbeitskräfte gibt es solchermaßen vorderhand genug, um deren Wohlergehen man sich zudem überhaupt nicht grämen muss, ist doch ihr Überleben gar nicht vorgesehen. So wird man die, die man loswerden will, los und profitiert auch noch an ihnen. „Vernichtung durch Arbeit“ mit tadelloser Rendite.
Der Errichtung des KZs Mauthausen folgt alsbald die eines zweiten Lagers auf dem Gemeindegebiet von Langenstein, nach einem nahen Bauernweiler Gusen genannt, das am 25. Mai 1940 eröffnet wird. „Das KZ Gusen bildete mit dem KZ Mauthausen eine Art Doppellager“, erläutert der Wiener Zeitgeschichtler Bertrand Perz in seinem kürzlich erschienenen Band über die Nachkriegsgeschichte der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Und: Der Bau der unterirdischen Fabrikanlagen in Sankt Georgen und die dafür vorgenommenen Erweiterungen des Lagers um Gusen II hätten ab 1944 dazu geführt, „dass sich im Lager Gusen lange Zeit mehr Häftlinge aufhielten als im Hauptlager Mauthausen selbst und Gusen auch eine höhere Zahl an Toten aufwies. Circa 60.000 Häftlinge verblieben für längere Zeit in den Gusener Lagern, mindestens 35.000 kamen dort zu Tode.“ Wenig erstaunlich, dass die Lager von Gusen als „schrecklicher Zwilling“ des Lagers Mauthausen in die Erinnerung mancher KZ-Überlebender eingegangen sind.
So ähnlich die Geschichte der „Zwillinge“ während des Krieges, so verschieden das, was nach der Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 folgt: Schon im Juni 1947 übergibt die sowjetische Besatzungsmacht das KZ Mauthausen an die junge Republik, und die verpflichtet sich, „die Gebäude des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen als Denkmal zur Erinnerung an die Opfer in ihre Obhut zu nehmen und zu erhalten“; Gusen I und die angrenzenden Steinbrüche dagegen werden bis 1955 als „Sowjetische Granitwerke“ weiterbetrieben, die Baracken von Gusen II unmittelbar nach Kriegsende niedergebrannt, um die drohende Ausbreitung von Seuchen zu unterbinden.
Der Sand wiederum, den die KZ-Häftlinge aus einem namenlosen Hügel südwestlich von St. Georgen gewühlt haben, um „Bergkristall“ zu installieren, bleibt nur kurz, zu einem gewaltigen Berg gehäuft, unweit des Stolleneingangs liegen: Dann schlägt ein findiger Kriegsheimkehrer aus seinem Verkauf Nachkriegskapital. Und die Republik hat auch noch was davon: Wer wiederaufbauen will, braucht schließlich Sand, und
so soll ein Gutteil des „Bergkristall“-Aushubs in den Bau des Donaukraftwerks Jochenstein geflossen sein. KZ-Arbeit mit Wiederaufbau-Mehrwert.
Seit 1947 hat somit heimische NS-Gedenkkultur nur mehr einen Namen: Mauthausen. Und weil einschlägige Bedürfnisse und Notwendigkeiten auf solche Weise tauglich an einem Ort entsorgt sind, kann man alles andere getrost der Nachkriegswirklichkeit übergeben: Das Lagersystem Mauthausen/Gusen schrumpft in der öffentlichen Wahrnehmung zum einsamen Punkt auf einem Berg, das meiste andere verschwindet spätestens nach 1955 unter Einfamilienhäusern, Thujenhecken, Gartenzwergen. Doch irgendwann und irgendwie holt die Geschichte jeden ein, der sich aus ihr wegstehlen will.
Wir haben den Grund um fünf Schilling für den Quadratmeter gekauft, das war doch kein Geld nicht. Wir waren alle nicht von da, wir haben erst mit der Zeit mitgekriegt, was da los war. Aber da war es schon zu spät. Da haben wir schon alle Haus gebaut, wie wir so manches gefunden haben, Knochen, ein Essbesteck und so, aber man hat das nicht so tragisch genommen. Die Fundstücke hat man weggeschmissen, wir haben da mitten in der Wiese einen tiefen Brunnen gehabt, da ist das Zeug alles hineingegangen, Erde drauf, das ist da ganz tief unten. (Eine Gusener Siedlerin, Jahrgang 1931)
Im Stillschweigen. Man hätte es wissen können. Spätestens 1956. Spätestens 1956 hätte man wissen können, dass sich das Gedenken an mehr als 35.000 Gusener KZ-Tote nicht in Wirtschaftswunder-Luft auflösen würde. 1956 richtet die Gastwirtin Stefanie Fulsche an die Finanzlandesdirektion Oberösterreich das Ansuchen „um käufliche Erwerbung des Grundstückes 1551/1“ in Langenstein. Auf diesem Grundstück freilich ragt nicht nur der letzte Rest des Gusener Krematoriums, besagter Doppelmuffelofen der Firma Topf & Söhne, in den Himmel, über die Jahre haben sich dem Ofen zwei bis dahin offiziell unbekannte Standobjekte beigesellt: zwei tonnenschwere Gedenksteine, der eine mit polnischer, der andere mit französischer Inschrift. Grundeigentümer Bund, einem Verkauf an Frau Fulsche – Krematoriumsofen hin oder her – nicht abgeneigt, sieht sich durch die beiden Steine zu investigativen Initiativen genötigt: Wer hat sie wohl wann dort aufgestellt? Und warum?
Als heimtückische Gedenksteinsetzer werden alsbald die französische KZ-Opfer-Gemeinschaft „Amicale de Mauthausen“ und die polnische Gesandtschaft in Wien ausgemacht, ein gesetzlich geschütztes Kriegsdenkmal vermag der Bund in den beiden Steinen dennoch nicht zu erkennen, und als der Langensteiner Bürgermeister auch noch ersucht, Krematoriumsofen samt Steinen doch gleich nach Mauthausen zu verlegen, weil man den neuen Siedlern auf den KZ-Grundstücken einen so schaurigen Anblick ersparen will, scheint das Geschick der ungeliebten Objekte besiegelt.
Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Ludwig Bernaschek weiß auch schon, wie die Beseitigung der Relikte am einfühlsamsten abzuhandeln wäre: „im Stillschweigen“, wie er in einem Schreiben vom Oktober 1958 Innenminister Helmer empfiehlt. Der wäre einem solchen Vorgehen auch nicht abgeneigt, aber leider, leider . . . „Leider lässt sich das praktisch nicht durchführen. In der Angelegenheit haben sich schon vor längerer Zeit französische und polnische Regierungsstellen nachdrücklich eingeschaltet. Es ist daher nicht möglich, eine Beseitigung oder Verlegung von Gedenkzeichen durchzuführen, ohne dass mit den erwähnten Stellen versucht wurde, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.“
Das Ergebnis eines Prozesses, der noch weitere sieben Jahre dauern sollte, lässt sich heute in Gusen besichtigen: Die Mailänder Architektengruppe BBPR entwirft Anfang der Sechziger eine Gedenkstätte, das „Memorial Gusen“, in das Krematoriumsofen und Gedenksteine an Ort und Stelle integriert werden. Und ein Langensteiner Bürgermeister findet bis zuletzt, in völliger Verkehrung der Frage, ob denn ein Siedlungsbau auf einem KZ-Gelände akzeptabel sei, der geplante Baukörper sei „mitten in der Siedlung Gusen fehl am Platz“.
Das Muster hat System: Von den Anfängen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im Jahr 1947 bis zum heutigen Tage gibt es kaum eine amtliche Initiative in Sachen hiesiger KZ-Gedenkkultur, die nicht von außen, meist von Opferverbänden, der Republik aufgenötigt worden wäre. Und regelmäßig sind es auch jene, die dafür bezahlen: So wurden die Kosten für das „Memorial Gusen“, für Errichtung und Grundstückserwerb, komplett von ausländischen Opferorganisationen aufgebracht, und auch 40 Jahre später wäre die Errichtung des neuen Besucherzentrums neben dem Memorial ohne maßgebliche finanzielle Unterstützung aus dem Ausland, namentlich aus Polen, undenkbar gewesen.
Und nicht nur dass wir uns unsere Gedenkverpflichtung von anderen bezahlen lassen: Im Falle des Memorials besaß die hiesige Finanzverwaltung gar die Raffinesse, von der grundstückserwerbenden „Amicale de Mauthausen“ Grunderwerbssteuer einzufordern. Warum nur einfach nichts bezahlen, wenn wir an unserer NS-Vergangenheit sogar verdienen können.
Wir sind oft vorbeigegangen am Krematorium, wer sich hingehen hat getraut, der war halt der Starke, so eine Art Mutprobe war das. Ich weiß nicht, wie es andere empfunden haben, aber ich hab‘ einen Bogen rundherum gemacht. Es gibt welche, die würden das am liebsten einebnen, zuschütten, etwas hinbauen, und gebts endlich eine Ruhe. Das ist vor allem meine Generation. Es will keiner mehr damit konfrontiert werden; auf der anderen Seite, ich denk‘ mir halt, wenn wir das wegtun, dann denkt überhaupt niemand mehr an das, wo er eigentlich wohnt. (Eine Gusener Siedlerin, Jahrgang 1966)
Hände zwischen den Zähnen. Obere Gartenstraße, Untere Gartenstraße, Parkstraße, Lerchenstraße, Ringstraße, Spielplatzstraße: So harmlos kommen sie heute daher, die Orte, an denen zwischen 1940 und 1945 systematisch geschunden und ausgebeutet, gefoltert und gemordet wurde. Und was nicht vorsätzliche Tat erledigte, geschah durch Unterlassung: Mangelernährung und hygienische Zustände jenseits jeder Vorstellungskraft zogen die Ausbreitung von Seuchen nach sich. Weder in Gusen I noch in Gusen II hatte man eine Gaskammer nötig, um sich die Bezeichnung „Mordlager“ zu verdienen; und wenn eine größere Anzahl Infizierter vielleicht doch einmal nicht schnell genug verreckte, dann konnte man noch immer eine einfache Baracke rundum abdichten, die Häftlinge hineintreiben, Zyklon B in den Raum werfen, um die Sache nicht unangemessen in die Länge zu ziehen. Das Ergebnis in der Zeugenaussage eines Gusener Lagerschreibers: „Die Gefangenen waren im Gesicht blau, fast schwarz, mit verzerrtem Mund, einige hatten geballte Hände zwischen den Zähnen, andere hatten Stücke von Decken im Mund, andere wiederum waren in einer brüderlichen verabschiedenden Umarmung verblieben.“
Mitte der Fünfziger, als die beiden Lagergelände allmählich besiedelt werden, ist davon keine Rede mehr. Sicher, da sind noch die einen oder anderen Relikte zu sehen, nicht nur das Krematorium, auch die Lagermauer von Gusen I samt Wachtürmen ist einigermaßen intakt, die „Bordellbaracke“, in der sich der SS genehme Häftlinge an Leidensgenossinnen aus dem Frauen-KZ Ravensbrück bedienen durften, zwei gemauerte Häftlingsblocks, zwei Baracken der SS, der riesige Schotterbrecher im alsbald wieder dem Reich des Anton Poschacher einverleibten Steinbruch – und nicht zuletzt der Eingang des KZs Gusen I, das sogenannte „Jourhaus“, also die Kommandantur der Anlage, Zentrum der Lagerführung und -verwaltung, Folterkeller inklusive.
Wer hier baut, stellt nicht viele Fragen: So gut wie alle sind sie Zuzügler, meist aus dem nördlichen Mühlviertel, die in und um Linz Beschäftigung gefunden haben, als Arbeiter aus der Einschicht finanziell nicht gerade wohlgebettet; aber hier, hier sehen sie dank günstigster Grundstückspreise ihre Chance, den Traum von den sonst völlig außer Reichweite liegenden eigenen vier Wänden zu verwirklichen. Der Gemeinde Langenstein ist auch gedient: Schließlich bringt der Grundstücksverkauf wenigstens ein bisschen Geld in die sonst eher dürftig bestückte Gemeindekassa. Somit haben alle was davon, dass sich KZ-Elend Parzelle für Parzelle in Einfamilienhaus-Seligkeit transformiert. Die Granitsteine aus Wachtürmen und Lagermauern taugen auch zum Eigenheimfundament, und wer denn hinter diesen Mauern vordem warum gefangen saß und wie es ihm da erging, wer will das schon so ganz genau wissen.
Man hat dann schon studiert, da sind ja immer die Leute gekommen, im Mai, die KZler, zum Jahrestag der Befreiung, und haben geschaut und geredet, man fragt halt dann doch, was war da los. Das haben wir ja gewusst, dass da ein KZ war, das haben wir ja schon gewusst, wie wir den Grund gekauft haben, aber wir haben wenig Ahnung gehabt, was sich in so einem KZ abgespielt hat. Sonst hätte sich vielleicht mancher geschreckt. (Eine Gusener Siedlerin, Jahrgang 1929)
Folterkammer mit Balustrade. Nicht nur Mauern und Türme, auch die sonstige KZ-Verlassenschaft findet Verwertung: Die SS-Baracken werden zu Arbeiterwohnungen für Poschacher-Beschäftigte; das KZ-Bordell wandelt sich zum adretten Zweifamilienhaus. Die beiden gemauerten Häftlingsblocks entdeckt Anfang der Sechziger ein gewisser Friedrich Danner für sich – und für seine Champignonfarm. Und in das Jourhaus zieht alsbald der „Kunststofferzeugungsbetrieb“ eines Karl Klug ein: Die Gemeinde verkauft ihm das Objekt, keine zwei Monate nachdem sie es ihrerseits vom Bund „zur Errichtung eines Kindergartens mit öffentlichem Spielplatz“ erworben hat. Als Klug geschäftlich scheitert, kauft Friedrich Danner auch das Jourhaus. Und so fahren alsbald Champignon-LKWs ein und aus, wo gar nicht so lang davor Zigtausende KZ-Häftlinge ins Verderben gingen.
Mitte der Achtziger kommt das Champignongeschäft in die Krise, das Unternehmen Danners steht vor dem Konkurs. Danners drei Kinder beschließen, mit privaten Mitteln Immobilien aus dem Unternehmen herauszukaufen, um den finanziellen Kollaps zu vermeiden. Gerhard Danners Wahl fällt auf das Jourhaus. Warum? „Viel mehr war halt nicht da.“ Anfang der Neunziger beginnt er, das Gebäude für sich als Wohnhaus zu adaptieren. Der Zustand zu diesem Zeitpunkt: „Abbruchreif. Aber jeder hat zu mir gesagt: Das ist ein schönes Haus, die Steine und das alles. So hab‘ ich das Ganze renoviert. Wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich es anders gemacht.“
Was auf ihn zukam, ist aus heutiger Sicht nicht schwer vorherzusagen: Nicht allein dass es KZ-Überlebende bei dem Gedanken grauste, es könne sich einer in jenem Gebäude, das wie nichts anderes den Terror der SS repräsentierte, gemütlich einrichten, auch viele andere, die etwa im Rahmen zeithistorischer Exkursionen hier vorbeikamen, musste diese Idee zumindest befremden. Wie konnte man in denselben Mauern heile Familienwelt spielen, die etwa für den KZ-Überlebenden Jerzy Wandel bis heute unauslöschlich eine „Schreckensvision“ sind?
Doch weder Republik noch Denkmalschutz schien es in den Neunzigern sonderlich zu beschäftigen, dass hier einer ein zentrales Denkmal heimischer Nazi-Architektur mit vorgesetzten Lauben samt Balustraden zur putzigen Landvilla verniedlichte. Und warum sollte ein kleiner Unternehmer aus dem kleinen Langenstein, mittlerweile ins Kunststoffrecycling-Geschäft gewechselt, über mehr historisches Verantwortungsgefühl verfügen als die Republik?
Seltsam genug, dass auch die beruflich zwangsläufig mit Vergangenheit Befassten dem Thema Konzentrationslager lange Nachkriegsjahrzehnte hindurch keine Beachtung schenkten. „Die Geschichtswissenschaft hat mit Konzentrationslagern überhaupt nichts anfangen können“, erinnert sich Bertrand Perz. Erst Anfang der Achtziger ändert sich das Bild: Hermann Langbein, Auschwitz-Überlebender, regt am Wiener Institut für Zeitgeschichte die Auseinandersetzung mit dem Lagersystem Mauthausen an, namentlich mit den Mauthausen zugehörigen Lagern Ebensee, Melk und Gusen. Zufälligerweise stehen drei angehende Historiker vor der Dissertation, und so teilen sich Florian Freund, Bertrand Perz und Werner Eichbauer die Arbeit. Freund übernimmt Ebensee, Perz übernimmt Melk und Eichbauer Gusen. Bertrand Perz: „Aus biografischen Gründen ist ausgerechnet die Gusen-Arbeit von Eichbauer nie zu einem Ende gekommen, das ist reiner Zufall.“ Die Folge: Bis zum heutigen Tag gibt es von österreichischer Seite keine Monografie zu Gusen. Und hätte nicht ein junger Ortsansässiger, Rudolf A. Haunschmied, Ende der Achtzigerjahre seine ehemalige Hauptschullehrerin Martha Gammer mit seinem Interesse für die KZs von Gusen angesteckt, es gäbe bis heute vermutlich keinerlei Gusen-Expertise im Land. Kommenden März wird immerhin die Arbeit des polnischen Gusen-Überlebenden Stanislaw Dobosiewicz in deutscher Sprache erscheinen: mehr als 60 Jahre nach Kriegsende, gut 30 Jahre nach ihrer Erstauflage in Polen.
Was sich in all diesen Fällen offenbart, ist längst kein individuelles, es ist ein gesamtgesellschaftliches Versagen. Und wenn wir Nachgeborenen heute mit dem Finger auf das entstellte Jourhaus zeigen und rufen: „Wie kann man nur!“, dann sollten wir uns im Klaren sein: Wir zeigen auf uns selber.
Von der Geschichte der Gegend habe ich, als ich da hergekommen bin, nichts gewusst. Wenn man in den Fünfzigerjahren in die Schule gegangen ist, da hat man gelernt, was Maria Theresia gemacht hat, Rudolf der Große. Wir haben wissen müssen, wie die Perchterln im Mühlviertel heißen, das war ganz wichtig, und welche politischen Bezirke es gegeben hat, aber vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg überhaupt nichts. Das hab‘ ich erst hier mitgekriegt, was da passiert ist. (Ein Sankt Georgener, Jahrgang 1946)
Klein-Lassing an der Gusen. Dass mancher Staat das eine oder andere Erbstück einer ungeliebten Vergangenheit gerne vergessen möchte, soll vorkommen. Dass einer freilich solches Erbe erst einmal gar nicht antritt, wird eher selten sein. Erst 1998 stand fest, dass der Bund das Eigentum an dem Projekt „Bergkristall“ akzeptieren muss: rund siebeneinhalb Kilometer Stollen mit Röhrenhöhen und -breiten zwischen vier und sechseinhalb Metern. Und 2001 war er sie auch gleich wieder los: Mit Schulen, Wohnhäusern, Amtsgebäuden und 279 weiteren sogenannten „Luftschutzstollen“ wechselten sie per 1. Jänner 2001 ins Eigentum der Bundesimmobiliengesellschaft, kurz BIG.
Womit aber haben wir es bei „Bergkristall“ konkret zu tun? Um „Luftschutz“ in gewisser Weise schon, aber nicht primär für Menschen, sondern für die Produktionsstraßen der Firma Messerschmitt: „Bergkristall“ sollte der Rüstung dienen – der Herstellung des ersten einsatzfähigen Düsenjägers der Welt, bekannt unter dem Kürzel Me 262. Nach Kriegsende haben zuerst die US-Truppen das Sagen in den Stollen: Das Me-262-Know-how ist hochbegehrt. Was noch übrig ist, holen Monate später die sowjetischen Besatzer aus dem Berg, und sie sind es auch, die 1947 die Stollen zu sprengen versuchen – mit spärlichem Erfolg. Der angestrebte Kollaps des Systems bleibt aus, dafür erweisen sich die Beschädigungen an etlichen Stollenkreuzungen ein halbes Jahrhundert später als brisante Hinterlassenschaft.
Bis dahin hat ein Ortsansässiger, Rudolf Pötsch, nicht nur den Sand, der beim Stollenbau von KZ-Häftlingen aus dem Berg gefördert wurde, gewinnbringend verkauft, nein, da der Grund über dem Stolleneingang sein Eigen ist, verlegt er sich auch dort aufs Sandgeschäft, gräbt Sand ab und vermarktet ihn. Daneben lukriert er aus der Vermietung der herrenlosen Stollen ein Zubrot: Die Champignons des Friedrich Danner gedeihen in „Bergkristall“-Luft prächtig.
1971 erwirbt Pötsch weiteren Grund über „Bergkristall“: Der Acker mit der Grundstücksnummer 291 sollte sich doch, ortsnah und in attraktiver Hanglage, in absehbarer Zeit und mit entsprechendem Profit als Bauland ausweisen lassen. Der Bürgermeister als Baubehörde ist da bekanntermaßen selten ein Problem. Und auch die Sache mit den Stollen drunter wird sich klären. 1984 gibt Pötsch ein entsprechendes Gutachten in Auftrag, das – erstaunlich genug – das erwünschte Ergebnis bringt. 1986 schenkt Pötsch den Baugrund in spe seinen beiden Töchtern. 1994 folgt der Bauplatzbescheid. „Ich hätt‘ dort nicht gebaut, ich sag‘ es Ihnen, wie es ist“, bekennt Rudolf Honeder, 1994 Unterzeichner des Bescheids und bis heute Bürgermeister von Sankt Georgen. Doch habe es nebst Gutachten vor allem „eine Zusage gegeben vom Vorvorbürgermeister“, das entsprechende Grundstück würde dereinst Bauland werden. Na dann.
Zügig werden nun die Parzellen über den Stollen verkauft, die Käufer werden auch gar nicht im Unklaren gelassen, worüber sie hier, auf der nun „Hasenfeld“ benannten Flur, ihre Häuser errichten werden. Was sie hingegen nicht erfahren: wie schnell selbst 40 Meter Überdeckung über den Stollen unter den geologischen Bedingungen dieses Hügels in nichts zerrieseln können. Die Rache der Vergangenheit nimmt ihren Lauf – und trifft in diesem Fall die Falschen.
Als die BIG 2001 „Bergkristall“ übernimmt, leitet sie umgehend eine Befundung des Systems in die Wege, steht freilich vor verschlossener Stollentür: Rudolf Pötsch behauptet einerseits, rechtmäßiger Eigentümer der Stollen zu sein – und ist andererseits tatsächlich rechtmäßiger Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich der einzige Stollenzugang befindet. Das juristische Scharmützel, das sich daraufhin zwischen Pötsch und BIG entspinnt, schiebt die dringend erforderliche Sanierung der Stollen über Monate hinaus. Erst ein Einsturz im Mai 2002 und die Erkenntnis, welche Kosten auf einen Stolleneigentümer in der allernächsten Zukunft zukommen würden, verhindern, dass Schlimmeres passiert: Pötsch gibt der BIG den Weg frei, die Rettung der Siedlung auf den vormals Pötschschen Gründen kann endlich beginnen, der Einbruch eines Hauses in die Stollen darunter verhindert werden.
„Wir sind in den Stollen unter unserem Haus gewesen, und da haben wir erst gesehen, was los ist“, erzählt ein Betroffener. „Diese unbeschreiblichen Verbrüche, wir haben sehr gute Lampen gehabt, du leuchtest hinauf, und du siehst keine Decke.“ Kommentar des BIG-Gutachters, Leopold Weber: „Für diesen Grund hätte es nie einen Bauplatzbescheid geben dürfen.“
In mehreren Bauphasen wurden mittlerweile die dringendsten Arbeiten erledigt, die Stollen unter den Häusern komplett mit Beton verfüllt. Kosten für die BIG: bisher acht Millionen Euro. Netto. Dass die Häuser auf dem „Hasenfeld“ mit diesem Mitteleinsatz ursächlich zusammenhängen, glaubt Pötsch bis heute nicht: „Wegen denen haben sie es nicht gemacht. Wegen denen direkt nicht.“ Aber er sagt ja auch, es „gehört fast alles den Juden“. Und: „Der Hitler wollte den Krieg gar nicht anfangen.“ In manchen Köpfen hat das Deutsche Reich bis heute nicht kapituliert.
Früher, da sind hie und da ältere Herrschaften aus Italien und Frankreich hierher gepilgert, da haben wir uns recht nett unterhalten mit manchen, die da gefangen waren. Das hab‘ ich eingesehen. Aber dass jetzt die Enkelkinder busweise hergeführt werden, da beim Gestrüpp und beim Zaun anstehen und auf diesen komischen Betonstein schauen, das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit geschichtlicher Aufarbeitung zu tun. (Ein Sankt Georgener, Jahrgang 1961)
Der ROI der Erinnerung. Wenn Ökonomen bestimmen müssten, wer wo wie zu gedenken habe, dann würde das ungefähr so klingen: „Ich bin der Meinung, man muss Erinnerung zentralisieren. Ich finde, es muss gscheit in Mauthausen sein, denn dort haben die Investitionen den besten ROI, Return on Investment, ich meine jetzt im Sinne von Bildung der Besucher, das Museum soll ja einen Take Home Value haben, und da ist es am besten, wenn es zentral an einer Stelle ist.“ So zumindest sieht Anton Helbich-Poschacher die Dinge, Enkel des Anton Poschacher und dessen Nachnachfolger an der Spitze des granitenen Familienimperiums.
Auch wenn’s Helbich-Poschacher vielleicht nicht glauben mag: Gedenken folgt nicht immer und ausschließlich dem Prinzip, es müsse bei minimalem Input maximaler Output erreichbar sein. Und so wird er vermutlich überrascht sein, wenn er in den nächsten Tagen Nachricht aus dem Bundesdenkmalamt erhält: dass nämlich der DESt- Schotterbrecher und die beiden SS-Baracken auf seinem Unternehmensboden unter Denkmalschutz gestellt werden. Gemeinsam mit allen anderen nennenswerten baulichen Relikten des KZs Gusen I. „Die Kriterien für den Denkmalbegriff sind klar definiert“, erläutert Österreichs Generalkonservatorin, Eva-Maria Höhle. „Ein Objekt muss von Menschenhand geschaffen und es muss von geschichtlicher, künstlerischer und/oder kultureller Bedeutung sein.“ Im Zusammenhang mit Objekten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs rücke das Kriterium der geschichtlichen Bedeutung in den Vordergrund. Doch weil in der Allgemeinheit mit dem Begriff Denkmal vor allem künstlerisch Wertvolles verbunden wird, sind, wenn’s um Denkmalschutz für Nazi-Bauten geht, Konflikte unvermeidlich. Das weiß auch Höhle: „Bei den Bauten der NS-Zeit war es immer so, dass mit Unterschutzstellungen ein hohes Maß an Emotionalität verbunden war.“ Nur: „Wenn der Staat den Auftrag des Gedenkens ernst nimmt und Mauthausen nicht nur als eine Alibistätte, und zwar als Alibi gegenüber den anderen Orten dieser Art sieht, dann muss er sich dazu bekennen. Und muss die notwendigen Konsequenzen ziehen.“
Er tut es spät, der Staat. Zu spät vielleicht. Immer öfter kollidiert das beständig wachsende und legitime öffentliche Interesse an der Vergangenheit von Gusen mit den mittlerweile auch schon jahrzehntealten Rechten privater Eigentümer. Wer soll Gerhard Danner wofür schelten, wenn er Fremden den Zugang auf sein Betriebsgelände verwehrt, auch wenn man von dort – und nur von dort – die Situation des Appellplatzes von Gusen I am besten fassen kann? Wer soll Huemerbau auf welcher Grundlage verwehren, das letzte freie Grundstück vor dem Gusener Krematorium via Wohnanlage zu verwerten, auch wenn dadurch die bislang freie Sicht auf das KZ-Memorial verbaut wird?
Dazu kommt noch das gespannte Verhältnis zwischen Einwohnern und Besuchern des KZ-Geländes. „In Gusen gibt es eine doppelte Irritation“, weiß Bertrand Perz. „Es kommen Leute hin und sind irritiert, dass da Leute wohnen. Und die Leute, die da wohnen, sind irritiert, dass das jemand irritierend findet.“ Aber: „Mit dieser Irritation müssen sie leben lernen, die kann man nicht einfach mit Abwehr behandeln. Und dafür kann man Bewusstsein schaffen, dafür sind öffentliche Debatten mit der Bevölkerung notwendig.“ Es gebe aber auch ein Missverständnis aufzuklären „bei denen, die dorthin kommen und sagen, wie kann man da wohnen: weil wir ständig in unserem Leben Gewalt an Orten, die irgendwann stattgefunden hat, ausblenden. Ich denke keine Sekunde daran, dass ich im alten AKH hier arbeite – und was die Geschichte dieses Zimmers ist.“
Immerhin: Manches scheint in Bewegung gekommen zu sein, nicht nur in Sachen Denkmalschutz. Hans Peter Jeschke bemüht sich nachdrücklich, mit seinem Projekt „Erinnerungslandschaft Mauthausen/Gusen“ die wahre historische Dimension der Topografie des Terrors östlich von Linz in den Blick zu rücken. Der junge Sankt Georgener Künstler Christoph Mayer wird kommenden Mai seinen „Audioweg Gusen“ vorstellen können, der zur Führung durch das KZ-Gelände den Soundtrack aus Stimmen von Opfern, Tätern und heutigen Anwohnern liefert. Und im gedenkmäßig zuständigen Innenministerium scheint man sich gar zu einem Ankauf des vor Verbauung stehenden Grundstücks vor dem Memorial durchgerungen zu haben, Verhandlungen sind jedenfalls im Gang.
Zu hoffen bleibt, dass auch in Erfüllung geht, was sich Martha Gammer und mit ihr viele der von ihr betreuten KZ-Überlebenden wünschen: dass der Zugang zu den Stollen von „Bergkristall“ wieder möglich wird. Da ist derzeit noch Rudolf Pötsch vor; und auch die BIG winkt ab. Doch die Zeit drängt: Wir Nachgeborenen können warten – die KZ-Überlebenden nicht.
Wolfgang Freitag, „Die Presse“, „Spectrum“, 27. Jänner 2007